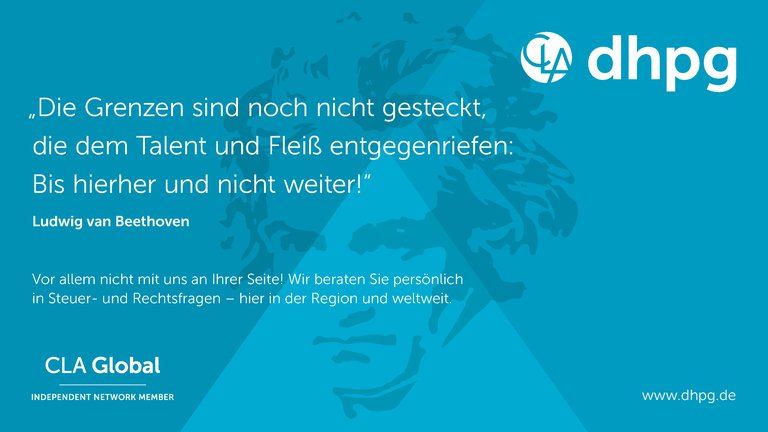The prologue the evening before the festival embarks on a spiritual search exploring today and the past, electronic sound worlds, gamba music from the 1600s, and Hildegard von Bingen’s chants from the dawn of Western music.
Thu. 28.8.2025
19:30, Bonner Münster
Prologue: Hildegarda
- Chamber Music, Vocal
- Past Event
- € 48
Contributors
- Hathor Consort
- Romina Lischka treble viol & director
- Liam Fennelly treble viol
- Thomas Beate alto viol
- Joshua Cheatham alto viol
- Irene Klein consort bass
- Nicholas Milne consort bass
- Heinali composition & sound art
- Andriana-Yaroslava Saienko vocals
Programme
»Ut re mi fa sol la« & »La sol fa mi re ut« à 5
Six Fantasias à 6
Dances and Divisions à 6: »Go from My Window«
In Nomine No. 1 à 5 & In Nomine No. 3 à 6 »Through all the parts«
Interspersed with
Heinali: Гільдеґарда (»Hildegarda«). Interpretations of works by Hildegard von Bingen for vocals und modular synthesizer
The concert at a glance
What can I expect?
What does it sound like?
Description
Ukrainian electronic musician Oleh Shpudeiko a.k.a. Heinali experiences the music of centuries past as »almost cruelly authentic«. With his synthesizer, he turns Hildegard von Bingen’s hymns into touching musical reflections of his experiences – interwoven with elemental Ukrainian singing techniques. These are combined with the equally free-spirited English viol consort music of the court of Elizabeth I.
After the concert, we invite you to join us and Bonn Münster for a cold drink in the festively illuminated cloister. The perfect way to get in the mood for four weeks of Beethovenfest in Bonn!
In cooperation with Münsterbasilika St. Martin
Heinali and Andriana-Yaroslava Saienko’s Performance is a coproduction of CTM Festival, Unsound Festival, GMEA–Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn and Athens & Epidaurus Festival
Downloads
More info
Magazine
All articles
Digital programme booklet (in German)
Thu. 28.8.
19:30, Bonner Münster
Prologue: Hildegarda
Mitwirkende
Heinali Komposition & Sound Art
Andriana-Yaroslava Saienko Gesang
Hathor Consort
Romina Lischka Diskantgambe & Künstlerische Leitung
Liam Fennelly Diskantgambe
Thomas Beate Altgambe
Joshua Cheatham Altgambe
Irene Klein Consort Bass
Nicholas Milne Consort Bass
Das Hathor Consort wird gefördert durch
Programm
Alfonso Ferrabosco II (1575–1628)
»Ut re mi fa sol la« & »La sol fa mi re ut« à 5
Orlando Gibbons (1583–1625)
Fantasias à 6 Nr. 2, 1 & 6
Heinali (*1985): Гільдеґарда (»Hildegarda«)
Hildegard von Bingen (1098–1179)
Responsorium »O tu suavissima virga«
Sequenz »O ignis Spiritus paracliti«
Orlando Gibbons
Fantasias à 6 Nr. 5, 4 & 3
Dances and Divisions à 6 »Go from My Window«
Alfonso Ferrabosco II
In Nomine à 5 Nr. 1
In Nomine à 6 Nr. 3 »Through all the parts«
Monsignore Markus Hoffmann, Stadtdechant
Steven Walter, Intendant
Grußworte
Über den Konzertabend
Konzertdauer: ca. 100 Minuten ohne Pause
Für ein ungestörtes Konzerterlebnis bitten wir Sie, auf Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.
Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.
Nach dem Konzert: CD-Verkauf und Signierstunde mit den Künstler:innen
Im Anschluss laden wir zum Empfang im Kreuzgang ein.
In Kooperation mit der Münsterbasilika St. Martin
Einleitung
»Wir erleben eine Zeitenwende« – mit diesen Worten verbalisierte Olaf Scholz 2022, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nachhaltig die Welt verändern würde.
»Zeitenwende« wurde damals zum Wort des Jahres – heute ist es schon fast wieder in Vergessenheit geraten. So schnell scheint sich seitdem die Weltgeschichte zu bewegen, fast zu schnell, um intellektuell und emotional noch Anschluss an die Ereignisse zu halten. Menschen stumpfen ab, zugleich überschlagen sich die Emotionen – ein Tanz auf der Messerspitze der Extreme.
»Alles ultra«, wie das Motto des diesjährigen Beethovenfests das Zeitgeschehen zusammenfasst. Die Musik der Hildegard von Bingen scheint dagegen beruhigend zeitlos. Was kann sie uns heute sagen? Für den ukrainischen Künstler Heinali spiegelt sich in ihrem unbedingten Pochen auf die eigene Stimme zweierlei: Erlösung und die Hoffnung auf Überleben in einem Krieg, die er mit dem Programm »Гільдеґарда«/ »Hildegarda« zu greifen sucht. Aber auch Hildegard selbst ist nicht der Zeit enthoben, sondern eine Figur auf einer Zeitschwelle.
Zu einer ähnlichen Umbruchszeit lebten die Komponisten Orlando Gibbons und Alfonso Ferrabosco, mit deren Musik das Hathor Consort die Aufführung von »Hildegarda« rahmt. Während der englische Hof Nordamerika kolonisiert, schreitet ihre Musik beständig zwischen alter Renaissance und neuem Barock. Der Prolog: Ein Abend von Zeitenwenden, in dessen Mitte die kaum sagbare Gegenwart Klang findet.
Zeitenwende I

Zeitenwende
WiderständischDie heilige Hildegard von Bingen gehört nicht nur als eine der wenigen Frauen zum Kreis der Kirchenlehrer:innen – sie ist auch abseits des Katholizismus eine Konsensfigur, als Vorläuferin des Feminismus oder als Naturforscherin. Schon zu Lebzeiten galt sie als heilig und erreichte breite Bevölkerungsschichten durch ihre Predigerreisen.
Sie war Mystikerin, Theologin und Philosophin, Medizinerin und Naturkundlerin, nicht zuletzt Äbtissin. Zudem komponierte sie Musik, die weit über die Tradition des Klostergesangs ihrer Zeit hinausging. Sie lebte im 12. Jahrhundert, das von Aufschwung und Neuanfang geprägt war.
»Gründerzeit 1200« heißt ein aktuelles Buch von Gisela Graichen und Matthias Wemhoff vielsagend: das Entstehen der städtischen Welt, das Ende des beständigen Hungers in Mitteleuropa. In dieser Zeit der Umbrüche reklamierte Hildegard von Bingen selbstbewusst Freiheiten, insbesondere für Frauen und die einfachen Menschen. Wobei diese Freiheit für sie nicht grenzenlos war, sondern immer auch ein Eingebundensein in die Umwelt und in die Gemeinschaft bedeutete.
Hildegard von Bingen
Die Äbtissin, Mystikerin, Dichterin, Komponistin und Universalgelehrte wurde 1098 als Tochter aus adeligem Hause geboren.
Um 1112 legte sie im Benediktinerkloster Disibodenberg, im heutigen Rheinland-Pfalz, ein Ordensgelübte ab. 1136 übernahm sie als Magistra die Führung der Nonnenschaft.
Ab 1141 erfährt sie Visionen, die sie bald darauf beginnt aufzuzeichnen und 1147 erstmals, mit päpstlicher Erlaubnis, öffentlich macht. In Folge dessen predigt sie öffentlich, wird überregional bekannt und korrespondiert mit bedeutenden Zeitgenoss:innen.
1150 gründet sie ein eigenes Kloster auf dem Rupertsberg bei Bingen. Hier entstehen zahlreiche Schriften aus Heilkunde und Kosmologie sowie philosophische und theologische Exkurse und Sammlungen ihrer Visionen.
Unter dem Titel »Symphonie der Harmonie der himmlischen Erscheinungen« sind 77 liturgische Gesänge erhalten sowie das Singspiel »Ordo virtutum«. Hildegard von Bingen stirbt 1179 in ihrem Kloster.
Fürchtet euch nicht
Hildegard von Bingen zählt heute zu den am meisten gespielten weiblichen Komponist:innen, zu denen des Mittelalters sowieso. So gesehen: Fast erstaunlich, dass eine ganz neue Interpretation noch möglich ist.
Tatsächlich hat die Entstehungsgeschichte von »Hildegarda«, der Annäherung des ukrainischen Musikers Oleh Shpudeiko alias Heinali, fast selbst den Charakter einer Vision: »Als eine russische Rakete nicht weit von meinem Studio in Kyjiw einschlug, erinnere ich mich lebhaft daran, wie mein Körper auf die Explosion reagierte, und zwar Millisekunden vor meinem Geist. Diese traumatische Explosion reduzierte mein Wesen auf einen Urzustand. Es herrschte nichts als Furcht – eine Furcht, die in der Heiligen Schrift das Erscheinen von Engeln begleitet, die verkünden: Fürchtet euch nicht«, schreibt Shpudeiko in den Liner-Notes zum Album über diesen Moment. Im Gespräch ergänzt er:
»Hildegards Person und Musik ist ein ferner Spiegel, durch den ich die Erfahrung des Krieges reflektiere.«
Dass Alte Musik auch das Heute ausdrücken kann, erfährt Shpudeiko bei einem Konzert mit Musik des Renaissance-Komponisten Josquin Desprez. »Es fühlte sich an, als würde diese ganze dramatische Kriegserfahrung, die ich passiv in mir trug, plötzlich auf der Bühne erscheinen. Und ich konnte sie zum ersten Mal externalisieren – durch die Musik eines Komponisten, der vor 500 Jahren gelebt hat. Eine solche Erfahrung hatte ich nie mit Musik der Gegenwart. Alte Musik kann für das Heute schmerzhaft relevant sein.«

Engelsgesang für Menschenstimme
Doch »Hildegarda« ist auch noch in einer anderen Hinsicht eine künstlerische Reaktion auf die Invasion Russlands in der Ukraine. Bisher erkundete Heinali Alte Musik, vor allem die des Mittelalters, zumeist mit den Möglichkeiten des ›Modularsynthesizers‹. Die auf den Körper wirkende Erfahrung von Krieg verändert seine Ästhetik, lässt sie organischer werden. Konkret bedeutet das: Neben die Elektronik tritt nun die menschliche Stimme als tragendes Element.
Modularsynthesizer
Der Modularsynthesizer ist ein elektronisches Musikinstrument, das sich dadurch auszeichnet, kein homogenes Instrument zu sein, sondern eben aus Modulen besteht – Einzelteile mit völlig unterschiedlichen Effekten, die beliebig kombiniert werden können. Manche erzeugen eigene Klänge, andere manipulieren sie, z. B. durch Filter oder Verstärker. Dann wiederum gibt es solche, die direkte Eingriffe in den Sound möglich machen, Knöpfe oder Regler. Die unendlichen Möglichkeiten der Kombination sorgen dafür, dass jeder Aufbau einzigartig ist und sich genau den Anforderungen der Musiker:innen anpassen lässt.
Seine musikalische Partnerin Andriana-Yaroslava Saienko wurde zunächst in Lwiw als Flötistin ausgebildet. Heute lebt sie im Exil in Tschechien, wo sie mehr und mehr die Tradition folkloristischer ukrainischer Gesangstechnik erkundet und neu denkt. »Hildegards Musik auf Latein zu singen mit dieser Art Stimme, das ist eine interessante Kombination«, sagt sie. »Zumal dieser Gesang in der Sowjetzeit nicht ausgeübt wurde. Jetzt müssen wir ihn neu entdecken. Aus dieser Perspektive symbolisiert er das Überleben und das Bleiben.«
»Hildegard von Bingens Musik hat eine bestimmte Aufführungstradition mit ätherischen, hellen Engelsstimmen, körperlos. Aber was ich in ihrer Musik fühle, ist eine starke körperliche Qualität, spürbar in den Intervallen (also den Tonschritten), der Bandbreite der Stimme, die sie verlangt. Die bietet die ukrainische Folklore-Tradition«, ergänzt Shpudeiko.
Vielleicht ist der dabei entstandene Soundtrack des »Hildegarda«-Projekts sogar etwas ganz Neues, was nicht mehr nur Heinali, Saienko oder Hildegard von Bingen zugeordnet werden kann. »Vielleicht sucht man sich gar nicht die Musik aus, die man bearbeitet, vielleicht ist es die Musik, die dich aussucht. Man könnte es auch so sehen, dass Hildegards Musik uns ausgesucht hat, in dieser Situation Ausdruck zu finden.«
Vokaltexte
Hildegard von Bingen
»O tu suavissima virga«»O süßester Zweig« ist ein Lobgesang auf Maria, der einen für das Mittelalter seltenen Blick auf Weiblichkeit offenbart: Im Bild von Gott als Adler, der sich ihr in Gestalt der Sonne zuwendet, erscheint Maria beinahe als gleichwertige Kraft.
Das Leuchten in diversen Formen gehört zu den gängigen Attributen der Muttergottes. Doch hier ist sie darüber hinaus aus sich selbst heraus erleuchtet.
Für die Musikwissenschaftlerin Beverly Lomer passt das zu Hildegards Bemühen, Frauen als gleichermaßen zu Vernunft befähigt zu zeigen wie Männer.
Vokaltext
LateinO tu suavissima virga
frondens de stirpe Jesse,
O quam magna virtus est
quod divinitas
in pulcherrimam filiam aspexit,
sicut aquila in solem
oculum suum ponit:
Cum supernus Pater claritatem Virginis
adtendit ubi Verbum suum
in ipsa incarnari voluit.
Nam in mistico misterio Dei,
illustrata mente Virginis,
mirabiliter clarus flos
ex ipsa Virgine
exivit:
Cum supernus Pater ...
Gloria Patri et Filio et Spiritui
sancto, sicut erat in principio.
Cum supernus Pater ...
Deutsche Übersetzung
Du allerliebster Zweig,
Grünend am Stamme Jesse!
Welch große Wunderkraft,
Dass die Gottheit
Auf die schönste Tochter blickte,
Wie der Adler der Sonne
Sein Auge zuwendet,
Als der himmlische Vater den Glanz der Jungfrau bemerkte,
Weil er wollte, dass sein Wort
In ihr selbst verkörpert wird.
Denn in Gottes geheimnisvollem Geheimnis,
Als der Geist der Jungfrau
Erleuchtet worden war,
Entsprang wundersam eine strahlende Blüte
Aus der Jungfrau selbst.
Als der himmlische Vater ...
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist
Jetzt und in Ewigkeit.
Als der himmlische Vater ...
Hildegard von Bingen
»O ignis Spiritus paracliti«Hildegard schrieb zahlreiche Hymnen auf den Heiligen Geist. Diese hier, dem Heiligen Geist als Tröster gewidmet, gehört zu den freudvoll überschäumendsten.
Für Hildegard ist diese auch in der christlichen Theologie schwer greifbare Substanz die Quelle des Lebens, die geheimnisvolle Kraft, die den ganzen Kosmos bewegt.
»Ich flamme als göttlich feuriges Leben über dem prangendem Feld der Ähren, ich leuchte im Schimmer der Glut, ich brenne in Sonne, in Mond und in Sternen, im Windhauch ist heimlich Leben aus mir und hält beseelend alles zusammen«, heißt es in einem ihrer überlieferten Texte.
Vokaltext
LateinO ignis Spiritus paracliti,
vita vite omnis creature,
sanctus es vivificando formas.
Sanctus es ungendo periculose
fractos, sanctus es tergendo
fetida vulnera.
O spiraculum sanctitatis,
o ignis caritatis,
o dulcis gustus in pectoribus
et infusio cordium in bono odore virtutum.
O fons purissime,
in quo consideratur
quod Deus alienos
colligit et perditos requirit.
O lorica vite et spes compaginis
membrorum omnium
et o cingulum honestatis: salva beatos.
Custodi eos qui carcerati sunt ab inimico,et solve ligatos
quos divina vis salvare vult.
O iter fortissimum, quod penetravit
omnia in altissimis et in terrenis
et in omnibus abyssis,
tu omnes componis et colligis.
De te nubes fluunt, ether volat,
lapides humorem habent,
aque rivulos educunt,
et terra viriditatem sudat.
Tu etiam semper educis doctos
per inspirationem Sapientie
letificatos.
Unde laus tibi sit, qui es sonus laudis
et gaudium vite, spes et honor fortissimus,
dans premia lucis.
Deutsche Übersetzung
Feuer des tröstenden Geistes,
Leben des Lebens aller Schöpfung
Heilig bist du, indem du den Formen Leben spendest.
Heilig bist du, indem du salbst die schwer Verletzten,
Heilig bist du, indem du reinigst
Die übelriechenden Wunden.
Atem der Heiligkeit,
Feuer der Barmherzigkeit,
Süßer Geschmack in der Brust,
Hineingegossen in die Herzen im Wohlgeruch der Tugenden.
Kristallklarer Quell,
In dem sichtbar wird,
Wie Gott die Verirrten sammelt
Und die Verlorenen sucht.
Schutzschild des Lebens,
Einheitswunsch aller Glieder
Und Gürtel des Anstands: Errette die Seligen.
Behüte die, die in Fesseln schlug der Feind,
Und löse die Bande den Gefesselten,
Welche die göttliche Kraft erretten will.
Machtvollster Weg, der zu allem vorgedrungen ist
Im Himmelhohen und auf Erden
Und in allen Abgründen,
Alle fügst und führst du zusammen.
Du machst die Wolken dahinziehen,
Die Lüfte fliegen, die Steine nässen,
Die Quellen Rinnsale bilden
Und die Erde das Grün ausschwitzen.
Stets auch bildest du Gelehrsame heran,
Von der Einhauchung der Weisheit
Beglückt.
Und so sei dir Preis, der du Klang des Lobes bist
Und Wonne des Lebens, Hoffnung und machtvollste Ehre,
Spendend des Lichtes Gaben.
Zeitenwende II
Zeitenwende
BarockAuch der Barock, die Epoche, in der die Komponisten Alfonso Ferrabosco II und Orlando Gibbons lebten, ist eine Zeit der Umwälzungen. Ferrabosco ist der uneheliche Sohn eines gleichnamigen englischen Hofkomponisten Er war Teil der Hofkapelle von Königin Elisabeth I. Nach ihrem Tod dient er ihrem Nachfolger König James I. als Komponist und Gambist und übernimmt die musikalische Erziehung des Kronprinzen. Orlando Gibbons kommt bald darauf als Organist an den Hof – auch er ist heute als Komponist geistlicher und weltlicher Werke bekannt.
König James I. ist der Sohn der schottischen Königin Maria Stuart, der legendären Gegenspielerin Elisabeths. Als sie ins englische Exil geht, wo sie von Elisabeth wegen Hochverrat hingerichtet werden soll, übernimmt James den schottischen Thron. 1603 stirbt Elisabeth kinderlos. Ausgerechnet der Schotte James ist die Nummer eins in der englischen Thronfolge.
Von nun an werden Schottland, England und Irland in Personalunion regiert. James versucht die Landesteile politisch zu vereinen, scheitert jedoch. Der Union Jack hingegen, welchen er als Symbol der Einheit einführt, bleibt bis heute als Flagge des Vereinigten Königreichs bestehen. In seine Regierungszeit fallen aber auch die berüchtigte Schießpulver-Verschwörung gegen das Parlament 1605 und die Gründung der ersten englischen Kolonial-Siedlung in Nordamerika: Jamestown.
Die Regierungszeit König James’ ist eine des Epochenumbruchs in den Künsten und der Philosophie. Die Renaissance geht ihrem Ende entgegen, sowohl in der Malerei, als auch in Architektur und Musik. Die Hofkomponisten Ferrabosco und Gibbons gelten als Übergangsfiguren der älteren Renaissance-Musik hin zum Barock. Vor allem prominent in dieser Zeit: das ›Gambenconsort‹ – ein kleines Ensemble bestehend aus mehreren Gambenspieler:innen.
Orlando Gibbons
Orlando, geboren 1583, ist nicht der einzige heute bekannte Gibbons-Komponist – er ist Teil einer Musikerfamilie. Früh wird er Sänger am King’s College in Cambridge, 1603 ist er im Umfeld der königlichen Hofkapelle nachweisbar, 1614 wird er schließlich Organist am Hof von König James. In der Privatkapelle des Kronprinzen Charles spielt er gemeinsam mit Alfonso Ferrabosco dem Jüngeren.
Außerdem wird er als Komponist von Werken für Tasteninstrumente hochgeschätzt. Vor allem polyphone Fantasien und Tänze, aber auch sakrale Chorwerke sind überliefert. Während der Vorbereitungen eines Konzerts mit der Hofkapelle anlässlich der Hochzeit des Kronprinzen mit Henrietta von Frankreich stirbt er mit 41 Jahren an einer Hirnblutung. Durch diesen frühen Tod ist sein Werk übersichtlich, aber bis heute ungewöhnlich beliebt: Pianist Glenn Gould nannte ihn seinen Lieblingskomponisten.
Königliche Gambisten
»Der König selbst und die Prinzen haben alle Gambe gelernt, dadurch ist diese Kompositionsweise, dieser Musik sehr gefördert worden«, erklärt Romina Lischko, die mit dem Hathor Consort die Musik der Ära wiedererstehen lässt.

Beim Prolog spielt Hathor sechs Fantasien und einen Tanz von Orlando Gibbons. Alfonso Ferrabosco ist mit vier Stücken vertreten, darunter zwei Varianten des »In Nomine«, einer beliebten Gattung englischer Vokalmusik im 16. Jahrhundert. Denn wenn auch beide Komponisten bekannt für höfische Musik sind, umfasst ihr Œvre ebenso sakrale Stücke. Das »In Nomine« ist dabei in der Consort-Musik eine typische Form. »Ursprünglich ist das Teil einer Messe«, erklärt Lischko. Komponiert wurde dabei ein ›Cantus firmus‹, eine feststehende Melodie, und ein mehrstimmiger Satz voneinander unabhängiger Stimmen, der den ›Cantus firmus‹ umspielt. »Und es sind in dieser Zeit hunderte Stücke geschrieben worden, wo immer eine Stimme eben diese langen Melodien spielt und ein polyphoner Satz rundherum verläuft.«
Ähnlich umspielt die Musik des englischen Hofes der frühen Neuzeit bei diesem Prolog die visionäre Musik einer mittelalterlichen Mystikerin. Sie spiegelt, wie die Folgen von Imperialismus und Krieg nach Erlösung verlangen. Wie die historische Figur Hildegard, rufen diese Klänge, selbstbewusst und zurückgenommen zugleich, den Menschen auf, Mensch zu werden.
Alfonso Ferrabosco II
»Ut re mi fa sol la«
Romina Lischka erklärt das Stück so: »Das ist eigentlich ein Hexachord« – also eine Reihe von sechs aufeinanderfolgenden Tönen – »der rauf und runter geht, aber chromatisch« – das heißt, die Reihe wird um einen Halbton versetzt und damit umgefärbt: »Die Skala steigt aufwärts und dann in die nächste Chromatik. Der Hexachord fängt auf C an, dann geht er auf Cis weiter, dann auf D und dann auf Dis, bis er durch den Zirkel gegangen ist – und dann geht er wieder zurück.«
Steffen Greiner
Wir danken den Mitgliedern des Freundeskreises!
PATRON
Founding members Arndt and Helmut Andreas Hartwig (Bonn)
PLATINUM
Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)
Godesberg Gastronomie & Event GmbH
Olaf Wegner (Bad Honnef)
Wohnbau GmbH (Bonn)
GOLD
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)
Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)
Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)
Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)
SILVER
Bernd Böcking (Wachtberg)
Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)
Dr. Helga Hauck (Wachtberg)
Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)
Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)
ON THE RECOMMENDATION of our patrons Arndt and Helmut Andreas Hartwig
Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama
BRONZE
Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Küster und Norbert Matthiaß-Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Silke und Andreas Tiggemann (Alfter) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)
Biografien
Heinali

Der Komponist und Elektronik-Künstler Oleh Shpudeiko alias Heinali erforscht die Überschneidungen von Vorsehung und Zufall, Vergangenheit und Gegenwart, Technologie und Sakralität. Seine recherchebasierte Technik ermöglicht es ihm, mehr- und einstimmig zu improvisieren, wobei er Techniken und Ideen von Komponist:innen und der Musiktheorie des Mittelalters sowie heutige Möglichkeiten der analogen Klangsynthese und generativen Musik nutzt.
Sein Live-Set »Organa« basiert auf der Polyphonie der Notre-Dame-Schule aus dem 12. bis 13. Jahrhundert und den Gesängen von Hildegard von Bingen.
Neben seinen Live-Auftritten und Aufnahmen komponiert Shpudeiko Musik für Computerspiele, Filme, Tanzproduktionen, Performances und Klanginstallationen. Zu seinen Werken zählen die preisgekrönte Musik für das Videospiel »Bound«, das Album »Madrigals« (2020), das für den Shevchenko National Prize nominiert wurde, sowie Kompositionen und Klanginstallationen im Auftrag des Museum of Modern Art New York, des National Art Museum of Ukraine und des Museum of Modern Art Odessa.
Andriana Yaroslava-Saienko

Andriana-Yaroslava Saienko ist eine vielseitige Musikerin, Sängerin, Schauspielerin und Gesangslehrerin aus Lwiw, wo sie zunächst Musik mit Schwerpunkt Flöte studierte. Seit 2019 hat sie ihr künstlerisches Spektrum erweitert, indem sie sich intensiv mit stimmlichem Ausdruck beschäftigte, Workshops besuchte und ihre Fähigkeiten in Schauspiel und Gesangstechnik verfeinerte.
Zu ihren musikalischen Partner:innen gehört Uliana Horbachevska, eine Schauspielerin und Forscherin ukrainischer Volkslieder. Mit Respekt für das Volkslied als dynamische, lebendige Kunstform erweckt sie das Repertoire durch eine raue, authentische Stimmgebung und eine nuancierte Interpretation zum Leben.
Ihr Wissen gibt sie auch in Gesangsworkshops und -kursen weiter. Ihre Arbeit zeichnet sich durch einen genreübergreifenden Ansatz aus, der traditionellen ukrainischen Gesang, Jazz, Improvisation, elektronische Musik und ein starkes akademisches Fundament miteinander verbindet. Saienkos Musik ist sowohl kollaborativ als auch persönlich; sie komponiert häufig zusammen mit ihrem Bruder, dem Pianisten Danylo Saienko.
Hathor Consort

Das Hathor Consort – benannt nach Hathor, einer Muttergottheit des Alten Ägypten – wurde 2012 von Romina Lischka gegründet. Unter ihrer künstlerischen Leitung widmet es sich der Musik der Renaissance und des Barock, in deren Zentrum ein Streichensemble aus Gamben steht.
Dieses polyphone Kammermusikrepertoire verbinden die Musiker:innen mit außereuropäischer Musik und mit zeitgenössischer klassischer Musik und Elektronik. Ihre Programme verweben Musik und Bilder zu poetischen, vielschichtigen Geschichten, die im Heute resonieren. Dabei arbeiten sie interdisziplinär mit Musik und visuellen Medien.
Die CDs des Hathor Consort wurden unter anderem mit dem Diapason d’Or ausgezeichnet. Es war zu Gast bei renommierten Festivals und Konzerthäusern in ganz Europa, darunter das Wiener Konzerthaus, die Elbphilharmonie, die Warschauer Philharmonie, Bozar Brussel, Wigmore Hall London, Kölner Philharmonie sowie die Early Music Festivals in Utrecht, York und Prag.
Konzerttipps
Mehr barocke Klänge
im BeethovenfestAwareness
Awareness
Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.
Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.
Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).
Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.
Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.
Programmheftredaktion:
Sarah Avischag Müller
Julia Grabe
Die Texte von Steffen Greiner sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.