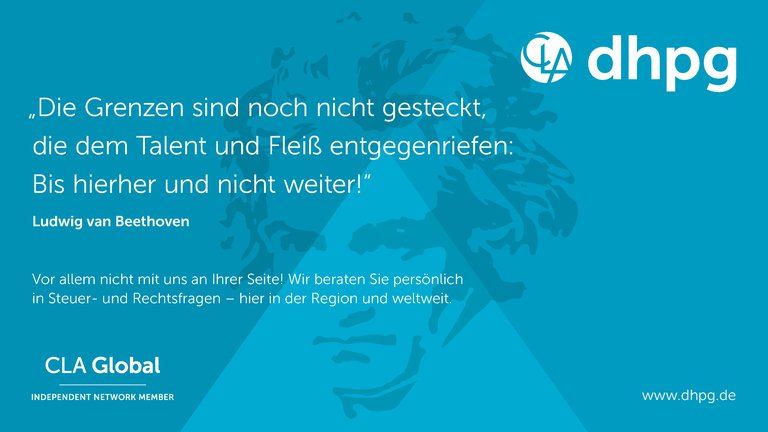Fabian Müller Klavier

Digital programme booklet (in German)
Fri. 19.9.
19:30, Kleine Beethovenhalle
Fabian Müller: Beethoven Sonatas IV
Mitwirkende
Programm
Fabian Müller (*1990)
Bagatellen (jeder Sonate vorangestellt)
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Klaviersonate Nr. 5 c-Moll op. 10/1
I. Allegro molto e con brio
II. Adagio molto
III. Finale. Prestissimo
Klaviersonate Nr. 11 B-Dur op. 22
I. Allegro con brio
II. Adagio con molta espressione
III. Menuetto
IV. Rondo. Allegretto
Pause
Klaviersonate Nr. 29 B-Dur op. 106 »Hammerklavier-Sonate«
I. Allegro
II. Scherzo. Assai vivace
III. Adagio sostenuto, Appassionato e con molto sentimento
IV. Largo – Un poco piu vivace – Allegro – Prestissimo
Über den Konzertabend
Konzertdauer: ca. 130 Minuten
Gastronomisches Angebot vor Ort
Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.
Für ein ungestörtes Konzerterlebnis bitten wir Sie, auf Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.
Der Freundeskreis Beethovenfest Bonn wünscht Ihnen bei den Konzerten seines Vorsitzenden Fabian Müller viel Freude!
Einleitung
Die beiden ersten Sonaten dieses Programms schrieb Ludwig van Beethoven relativ früh, an der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert. Das erste Werk aus Opus 10 ist sozusagen die kleine Schwester der »Pathétique« und der allerletzten Sonate, mit denen sie die Tonart c-Moll gemeinsam hat. Opus 22 steht dagegen in B-Dur – wie die berühmte »Hammerklavier-Sonate«. Mit dieser schließt Fabian Müller seine auf zwei Festival-Jahrgänge verteilte zyklische Aufführung von allen 32 Klaviersonaten Beethovens ab. In der »Hammerklavier-Sonate« werden alle nur denkbaren spiel- und kompositionstechnischen Möglichkeiten ausgeschöpft. So zeigt sich in Beethovens viertletztem Gattungsbeitrag noch einmal in einem einzigen Werk die Universalität des Wiener Klassikers.

Klaviersonate Nr. 5
Zahlen und Fakten: Ludwig van Beethoven, Klaviersonate Nr. 5 c-Moll op. 10/1
Entstehung: [1795]/1796
Widmung: Gräfin Anna Margarete von Browne
Meditation und Kompaktheit
Anders als Beethovens zuvor geschriebene Sonaten umfasst das c-Moll-Werk aus Opus 10 nur drei statt vier Sätze. Dadurch rückt das Adagio molto – ein besonders langsames Adagio also – ins Zentrum der Komposition. Es dauert zudem etwa genau so lange wie die Außensätze zusammen. Der langsame Satz scheint schon zu Beginn des zweiten und des vierten Taktes zum Stillstand zu kommen, bevor das Thema bei seinen Wiederholungen durch Verzierungen und raschere Notenwerte belebt wird. Der meditativen Ruhe und Ausdehnung des Adagios steht der kompakte erste Satz mit einer großen Gestaltenfülle gegenüber. Er beginnt mit einer in die Höhe schießenden Dreiklangs-Figur, die damals als »Mannheimer Rakete« bezeichnet wurde. (In Mannheim residierten einige Komponisten, die maßgeblich zur Entwicklung des klassischen Stils beitrugen.)
Die Tonart c-Moll
Die Sonate Nr. 5 ist mit Beethovens fünfter Sinfonie verwandt: Nicht nur durch die Gewicht und Dramatik signalisierende Tonart c-Moll, sondern auch durch das weltberühmte rhythmische Motiv (kurz-kurz-kurz-lang, »ta ta ta taaa«). Es taucht im Mittelabschnitt des Sonaten-Finales auf und eröffnet die später entstandene Sinfonie. Im Schluss dieses letzten Satzes zeigt sich Beethoven als Meister des sozusagen ›modularen‹ Komponierens: Er baut aus Bestandteilen der beiden Themen ein neues zusammen.
Eine »zu freye Schreibart«?
Beethoven war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung seiner fünften Sonate in Wien längst ein berühmter Mann, um dessen Werke verschiedene Verlage konkurrierten. Typischerweise bescheinigte man dem Komponisten Genialität, monierte aber gleichzeitig seine Neigung zur »Bizarrerie«. So schrieb ein Kritiker über das Opus 10, »Hr. v. B.« müsse sich »etwas vor der bisweilen zu freyen Schreibart […] in Acht nehmen«. Zum Glück beherzigte Beethoven diesen Ratschlag nicht.

Klaviersonate Nr. 11
Zahlen und Fakten: Ludwig van Beethoven, Klaviersonate Nr. 11 B-Dur op. 22
Entstehung: 1799/1800
Erste Skizzen: 1795/96
Widmung: Graf Johann Georg von Browne
Virtuosität und Kontrast
Mit den Worten »Diese Sonate hat sich gewaschen« kündigte Beethoven sein Opus 22 in typisch unverblümter Sprache seinem Verleger an. Der Ausspruch bezieht sich wahrscheinlich vor allem auf die bedeutenden spieltechnischen Ansprüche des ersten Satzes. Aus seinem zunächst leise angestimmten, in Pausen verstummenden Anfangsmotiv entwickelt sich ein virtuoser Aufschwung mit schnellen Figuren in der linken Hand. Besonders ausgeprägt ist in diesem Allegro con brio (einem »spritzigen« Allegro also) die Dramaturgie der Kontraste – zwischen Dur und Moll, zwischen lauten und leisen, lyrischen und dramatischen, ein- und mehrstimmigen Passagen.
Der zweite, ungewöhnlich ausgedehnte Satz ist ein fast arienhafter Gesang mit zu Beginn bittersüßen, am Anfang des zweiten Teils dann sehr gewagten Dissonanzen. Beethoven setzt sie immer wieder auf den betonten ersten Schlag des Taktes.
Heiteres, Erhabenes
Weniger gewichtig als die ersten beiden Sätze wirkt die zweite Hälfte der Sonate. Das Menuett klingt, trotz seines unerwartet heftigen Mittelteils, wie eine kleine Hommage an Haydn und Mozart. Und für das Finale hat Beethoven ein zärtlich fließendes Thema mit reich gestalteten Mittelstimmen komponiert, das in immer neuen, liebevoll ornamentierten Varianten erklingt.
Das Werk gilt als eine Art Bilanz der frühen Schaffensperiode Beethovens. Schon in seiner folgenden zwölften Sonate wird der Komponist viel freier mit den traditionellen Satzcharakteren umgehen. Dennoch hat das Urteil eines zeitgenössischen Kritikers Bestand: Die Sonate vereinige »auf eine sehr originelle Weise Glänzendes und Kraftvolles, Feierliches und Rührendes, Heiteres, Gefälliges [und] Erhabenes«.

Klaviersonate Nr. 29
Zahlen und Fakten: Beethoven, Klaviersonate Nr. 29 B-Dur op. 106 »Hammerklavier-Sonate«
Entstehung: 1817/18
Widmung: Erzherzog Rudolph von Österreich
Originaler Titel: »Große Sonate für das Hammerklavier« (Erstdruck Wien 1819)
Uraufführung: 18. Mai 1836 in Paris durch Franz Liszt
Die singuläre »Hammerklavier-Sonate«
Singulär ist die längste von Beethovens Klaviersonaten – sie nimmt je nach Interpretation zwischen 40 und 50 Minuten in Anspruch – schon durch die gewaltigen Anforderungen, die sie an technische Fähigkeiten, musikalische Gestaltungskraft und Konzentrationsvermögen stellt. Eine öffentliche Aufführung des bis heute gefürchteten Werks wagten in den ersten Jahrzehnten nach Beethovens Tod nur Wenige, darunter allerdings zwei der größten pianistischen Legenden des 19. Jahrhunderts: Franz Liszt 1836 (der anwesende Hector Berlioz war fasziniert) und, etwa 20 Jahre später, Clara Schumann.
Widmung
Die Sonate beginnt mit massiven Akkordfolgen. Sie klingen nach festlichen Fanfaren, doch gleichzeitig eigentümlich heftig. Auf einem Skizzenblatt hat der Komponist die Worte »Vivat! Vivat! Rudolphus« unter das Thema geschrieben – und damit auf Erzherzog Rudolph von Österreich angespielt, den Widmungsträger des Werks.
Schwer, schön und groß
»Was schwer ist, ist auch schön, gut [und] groß«, sagte Beethoven einmal. Das Motto passt auf kaum ein Werk so präzise wie auf die »Hammerklavier-Sonate«. »Schön« ist die unzweifelhaft »schwere« Sonate mindestens im Adagio sostenuto. Dessen zwei Themen, die immer wieder neu umspielt und beleuchtet werden, erzählen von einer bis in die Verzweiflung reichenden Trauer. Und doch liegt in den gelegentlichen Auflichtungen von Moll nach Dur auch Trost.
»Groß« ist das Werk durch seine furchtlose Erkundung radikal auseinanderstrebender Energien. So geht dem womöglich längsten langsamen Satz, den der Komponist überhaupt geschrieben hat, ein besonders kurzes und prägnantes Scherzo voraus. Auf die beseelte Zartheit des Adagios antwortet die zuweilen erbarmungslose Ausdrucksgewalt des Finales; und dieses Finale, mit dessen Fuge Beethoven auf eine besonders strenge Kompositionstechnik zurückgreift, beginnt mit einer außergewöhnlich frei gestalteten, wie improvisiert wirkenden Einleitung.
Vergangenheit und Zukunft
Das ungewöhnlich lange Fugenthema im Finale der »Hammerklavier-Sonate« beginnt mit einem großen Sprung, dem sich ein Triller anschließt. In den folgenden Passagen wird das Thema beschleunigt, verlangsamt, umgekehrt und an einer Stelle sogar rückwärts – also von hinten nach vorne – gespielt. Inmitten dieser bahnbrechenden, in die musikalische Moderne vorausweisenden thematischen Arbeit erklingt unerwartet ein zweites Thema. Für einen flüchtigen Moment kehrt eine fast sakral anmutende Ruhe ein.
Mit den Fugen seines Spätwerks erwies der Komponist der Barockmusik im Allgemeinen und Johann Sebastian Bach im Besonderen seine Referenz. Beethovens Zukunftsmusik ist zugleich eine Musik, die sich der Vergangenheit bewusst ist. Auch darin liegt die unübertroffene »Größe« der »Hammerklavier-Sonate«.

»Hammerklavier«
In den 1810er-Jahren erkundigte sich der damals patriotisch gestimmte Beethoven bei mehreren Experten, durch welches deutsche Wort man die gängige italienische Bezeichnung des Tasteninstruments als »Pianoforte« ersetzen könnte. Bereits sein Opus 101 nannte er daraufhin eine Sonate für das »Hammerklavier«; aber nur das im Oktober 1819 veröffentlichte B-Dur-Werk op. 106 ist als »Hammerklavier-Sonate« bekannt geworden.
Benedikt von Bernstorff
Interview

Interview
mit Fabian MüllerSie spielen als Präludium zu jeder Sonate eine von Ihnen selbst komponierte Bagatelle. Wie werden diese kurzen Stücke vom Publikum aufgenommen?
Fabian Müller: Auf die Bagatellen gibt es sogar besonders starke Reaktionen. Manche lösen Begeisterung, manche Staunen, wieder andere Unverständnis aus. Aber das gefällt mir gerade. Ich möchte nicht, dass meine Konzerte »konsumiert« werden, sondern dass man gemeinsam etwas erlebt und darüber spricht.
Für den Abschluss ihres Zyklus haben Sie sich die so berühmte wie berüchtigte »Hammerklavier-Sonate« aufbewahrt.
Beethoven hat einige Werke für das Publikum und andere für sich selbst komponiert. Aber die »Hammerklavier-Sonate« ist für die Zukunft geschrieben, sie ist eigentlich musikalische Science-Fiction. Die Schöpfungsenergie, die im vierten Satz zum Ausdruck kommt, ist so wild, dass die Musik einem fast unmenschlich und wie ein Naturereignis vorkommt. Man stellt sich einen Gott vor, der in den Farbtopf greift. Im langsamen Satz hat man dagegen das Gefühl, in einen Ozean der Menschlichkeit einzutauchen. Er wirkt wie eine Meditation, wie eine Reise durch die menschlichen Gefühle.
Wir danken den Mitgliedern des Freundeskreises
PATRON
Founding members Arndt and Helmut Andreas Hartwig (Bonn)
PLATINUM
Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)
Godesberg Gastronomie & Event GmbH
Olaf Wegner (Bad Honnef)
Wohnbau GmbH (Bonn)
GOLD
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)
Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)
Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)
Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)
SILVER
Bernd Böcking (Wachtberg)
Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)
Dr. Helga Hauck (Wachtberg)
Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)
Dr. Luciano und Ulrike Pizzulli (Bonn)
Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)
ON THE RECOMMENDATION of our patrons Arndt and Helmut Andreas Hartwig
Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama
BRONZE
Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Heike Fischer und Carlo Fischer-Peitz (Königswinter) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Prof. Ingeborg Henzler und Dr. Mathias Jung (Bendorf-Sayn) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Matthiaß-Küster und Norbert Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)
Biografie
Fabian Müller
BiografieDer gebürtige Bonner Fabian Müller hat sich in den vergangenen Spielzeiten als einer der bemerkenswertesten Pianist:innen seiner Generation etabliert. Für großes Aufsehen sorgte er 2017 beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb in München, bei dem er gleich fünf Preise erhielt. Seither entwickelt sich seine Konzerttätigkeit auf hohem Niveau: 2018 gab er mit dem Bayerischen Staatsorchester sein Debüt in der New Yorker Carnegie Hall und trat erstmals in der Elbphilharmonie auf. In der vergangenen Saison führte er auf Einladung von Daniel Barenboim sämtliche Klaviersonaten Beethovens im Berliner Pierre Boulez Saal auf und begann den Zyklus ebenso beim Beethovenfest Bonn.
Fabian Müller musiziert regelmäßig mit bedeutenden Klangkörpern wie dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Seine rege Beschäftigung mit der Musik Johann Sebastian Bachs spiegelt sich unter anderem in einer längerfristig angelegten Zusammenarbeit mit den Berliner Barock-Solisten, einem Ensemble der Berliner Philharmoniker. Beim Rheingau Musik Festival führt er seit dem vergangenen Sommer, verteilt auf mehrere Jahre, sämtliche Klavierkonzerte Mozarts auf, die er vom Klavier aus leitet.
Auf der Suche nach seinem eigenen Klangideal gründete er außerdem sein eigenes Kammerorchester: The Trinity Sinfonia. Das Ensemble debütierte 2023 beim Rheingau Musik Festival; mit ihm führt er als Dirigent ab 2024 sämtliche Sinfonien Beethovens beim Bonner Beethovenfest auf.
Neben seiner Konzerttätigkeit engagiert sich Fabian Müller im Bereich der Musikvermittlung. Im Rahmen des Klavier-Festivals Ruhr arbeitet er jedes Jahr mit mehr als 300 Kindern zusammen, die sich auf schöpferische Weise mit moderner Musik auseinandersetzen. Dieses Projekt wurde 2014 mit dem Junge-Ohren-Preis und 2016 mit einem ECHO Klassik ausgezeichnet.
Fabian Müller verbindet eine exklusive Zusammenarbeit mit dem Label Berlin Classics. Seine erste CD erschien im Herbst 2018 und enthält Soloklavierwerke von Johannes Brahms. 2020 wurde dort eine weitere CD mit Werken von Beethoven, Schumann, Brahms und Rihm veröffentlicht. Im Frühjahr 2022 folgte sein drittes Album, das die drei letzten Sonaten Schuberts beinhaltet. Darüber hinaus erschien bei der Deutschen Grammophon ein Mozart-Album, das er zusammen mit Albrecht Mayer einspielte.
Dem Beethovenfest in seiner Heimatstadt ist Fabian Müller tief verbunden: Durch seine Beethovensonaten-Konzertreihen und als erster Vorsitzender des Freundeskreises Beethovenfest Bonn e. V.
Konzerttipps
Awareness
Awareness
Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.
Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.
Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).
Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.
Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.
Programmheftredaktion:
Sarah Avischag Müller
Julia Grabe
Die Texte von Benedikt von Bernstorff sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.