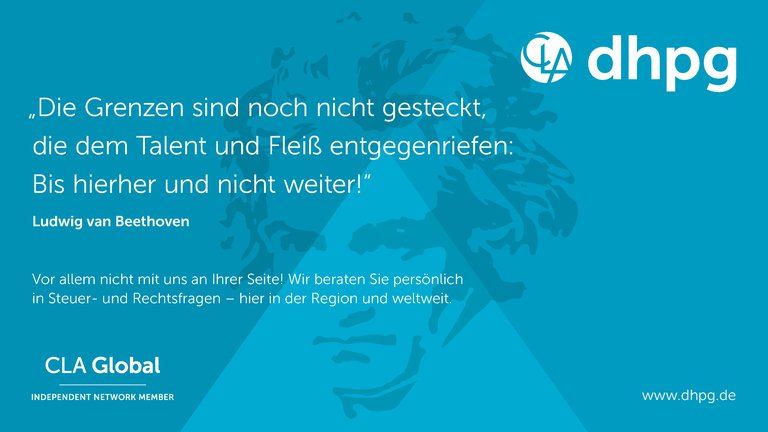»It’s not classical, regimented music, but incredibly imaginative. Like in a Shakespeare play: You have to be willing to be completely honest on stage. Then you’ll be transported to the craziest experiences and adventures.«
– Fabian Müller
Fri. 12.9.2025
19:30, Pantheon Theatre
Fabian Müller: Beethoven Sonatas III
- Piano
- Past Event
- € 38

Contributors
- Fabian Müller piano
Programme
Bagatelles
Piano Sonata No. 8 in C Minor, op. 13 »Pathétique«
Piano Sonata No. 12 in A-flat Major, op. 26
Piano Sonata No. 10 in G Major, op. 14/2
Piano Sonata No. 28 in A Major, op. 101
The concert at a glance
What can I expect?
Beethoven’s most impetuous piano sonata, the symbol of musical Sturm und Drang: The »Pathétique«, followed by three sonatas of a completely different character.
What does it sound like?
Description
The essence of Beethoven as an »ultra« composer – rebellious, explosive, startlingly emotional: that is the »Pathéthique«. Fabian Müller directly follows it with one of the composer’s calmest sonatas, the Twelfth. Still waters and roaring seas, both are encompassed in the cosmos of the complete thirty-two piano sonatas the pianist traverses in his Beethovenfest cycle. No. 28, which concludes the concert, stands at the threshold of the enigmatic and dreamy late works.
The video was recorded in the Pierre Boulez Saal for Fabian Müller's Beethoven piano sonata cycle for the 2024/25 season.
Magazine
All articles
Digital programme booklet (in German)
Fri. 12.9.
19:30, Pantheon Theatre
Fabian Müller: Beethoven Sonatas III
Mitwirkende
Fabian Müller Klavier
Programm
Fabian Müller (*1990)
Bagatellen (jeder Sonate vorangestellt)
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Klaviersonate Nr. 8 c-Moll op. 13 »Pathétique«
I. Grave – Allegro di molto e con brio
II. Adagio cantabile
III. Rondo Allegro
Klaviersonate Nr. 12 As-Dur op. 26
I. Andante con variazioni
II. Scherzo. Allegro molto
III. Maestoso andante (Marcia funebre sulla morte d’un eroe)
IV. Allegro
Pause
Klaviersonate Nr. 10 G-Dur op. 14/2
I. Allegro
II. Andante
III. Scherzo. Allegro assai
Klaviersonate Nr. 28 A-Dur op. 101
I. Etwas lebhaft, und mit der innigsten Empfindung. Allegretto, ma non troppo
II. Lebhaft, marschmäßig. Vivace alla marcia
III. Langsam und sehnsuchtsvoll. Adagio, ma non troppo, con affetto
IV. Geschwind, doch nicht zu sehr, und mit Entschlossenheit. Allegro
Über den Konzertabend
Konzertdauer: ca. 120 Minuten
Gastronomisches Angebot vor Ort
Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.
Für ein ungestörtes Konzerterlebnis bitten wir Sie, auf Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.
Der Freundeskreis Beethovenfest Bonn wünscht Ihnen bei den Konzerten seines Vorsitzenden Fabian Müller viel Freude!
Einleitung
Das diesjährige dritte Programm von Fabian Müllers Beethoven-Zyklus umfasst zwei Schwellenwerke des Komponisten: In dessen Sonatenschaffen gilt Opus 26 als Überleitung zur mittleren Schaffensperiode und Opus 101 als Eröffnung des Spätwerks. Ein Solitär ist dagegen die berühmte »Pathétique«, eine der ganz wenigen Sonaten, denen Beethoven selbst einen Beinamen zuordnete. Der düsteren Atmosphäre und der inneren Anspannung dieses Werks, das wie die fünfte Sinfonie in c-Moll steht, stellt Fabian Müller die Sonate Nr. 10 gegenüber. Sie ist von zarter Lyrik und zugleich von feinem Humor gekennzeichnet. So vermittelt auch diese Werkauswahl einen Eindruck vom universalen Ausdrucksvermögen, das Beethoven wie kaum jemandem sonst zur Verfügung stand.
Klaviersonate Nr. 8
Zahlen und Fakten: Beethoven, Klaviersonate Nr. 8 c-Moll op. 13 »Pathétique«
Komponiert: ? bis 1798
Gewidmet: Fürst Karl von Lichnowsky, Unterstützer Beethovens
Die pathetische Sonate
Beethoven ließ seine achte Sonate im Herbst 1799 unter dem Titel »Grande Sonate Pathétique« veröffentlichen. Die Bezeichnung verweist stärker auf den emotionalen Inhalt als auf die Form: Denn anders als die vom Komponisten zuvor veröffentlichten ›großen‹, viersätzigen Sonaten umfasst die »Pathétique« nur drei Sätze. Mit einer Spieldauer von etwa 20 Minuten ist sie auch nicht besonders lang. ›Groß‹ ist allerdings unzweifelhaft der Ausdruckscharakter des Werks.
Es beginnt mit einem Motiv aus düsteren Akkorden in Moll, das zweimal auf höherer Stufe wiederholt wird. Eine abwärts stürzende Kaskade schließt sich an. Später kommt Beethoven mehrmals auf diese aufgewühlte Einleitung (Grave) zurück. Der Satz wechselt zwischen diesen langsamen, düster fragenden Passagen und schnellen Abschnitten hin und her – wie ein innerer Dialog zwischen depressiver und manischer Seelenverfassung. Die hastig aufsteigenden Figuren in den schnellen Teilen (Allegro di molto e con brio) wirken wie eine Fluchtbewegung. Ein weiteres Thema des Satzes nimmt den dialogischen Charakter auf: Die rechte Hand springt zwischen hoher und tiefer Lage, wobei sie immer wieder die linke übergreift.
Gesang und Pathos
Zwischen zwei Sätzen, die in Moll beginnen und enden – der letzte schließt mit einer wütenden Abwärts-Skala – steht das Adagio cantabile. Das in As-Dur notierte Hauptthema, das zu den schönsten und berühmtesten Melodien Beethovens zählt, wird bei seinem insgesamt fünfmaligen Erscheinen nicht angetastet, sondern nur von wechselnden Figurationen umspielt. Der Satz endet mit einem ausdrucksvollen Abgesang.
Pathétique versus pathetic
Von Beethoven zur HBO-Serie »Succession«Der englische Begriff »pathetic« weicht von der deutschen Bedeutung des Wortes ab und heißt so viel wie erbärmlich, lächerlich oder mitleiderregend – Adjektive, die gut zu den abgründigen Charakteren aus der amerikanischen Erfolgsserie »Succession« passen. In ihr dreht sich alles um die Frage, wer das Erbe des Patriarchen an der Spitze eines Medien-Imperiums antreten soll. Musikalisches Erkennungszeichen der Serie ist die Titelmelodie, die im Hip-Hop-Stil unverkennbar eine Passage aus dem ersten Satz der »Pathétique«-Sonate variiert. So hat Beethoven sogar zum Soundtrack einer ›ultra‹-zeitgenössischen Film-Erzählung beigetragen.
Klaviersonate Nr. 12
Zahlen und Fakten: Beethoven, Klaviersonate Nr. 12 As-Dur op. 26
Komponiert: 1800/01
Gewidmet: Fürst Karl von Lichnowsky
Variation und Marsch
Als im Jahr 1800 Beethovens erste Sinfonie uraufgeführt wurde, hatte der Komponist bereits elf Klaviersonaten veröffentlicht. Mit dem As-Dur-Werk seines Opus 26 beginnt nach Ansicht der Musikwissenschaft die »mittlere Periode« im Sonaten-Schaffen des Komponisten. Es ist die erste Klaviersonate Beethovens mit einem Variationen-Satz – und dieser steht untypischerweise am Anfang des Werks. Zunächst wird ein gesangliches Thema angestimmt, das in der Moll-Variation einen unruhig-drängenden Charakter annimmt. Auf ein Gespräch zwischen tiefer und hoher Lage folgt die letzte Variation, in der sich die Melodie in fließende Figurationen auflöst.
Variationen
Der Begriff meint eine musikalische Gattung oder Satzform. Zu Beginn wird ein Thema vorgestellt, ein geschlossener musikalischer Abschnitt. Dieses Thema wird nun mehrmals in immer unterschiedlicher Gestalt wiederholt: Jeder dieser Abschnitte ist eine ›Variation‹ des Themas. Typischerweise kann man die Grundgestalt des Themas bei jeder Wiederholung noch erkennen – zum Beispiel bleibt die Länge und Struktur immer gleich, ebenso das Verhältnis der Akkorde zueinander.
Es gibt verschiedene Variations-Techniken. Etwa wird die Melodie des Themas durch zwischengeschobene kürzere Noten umspielt und verziert, oder es werden neue Begleitungs-Muster eingeführt.
Vor Beethoven war dieser Satztyp in Klaviersonaten eher selten. Die Variationen waren eine Gattung, in der Beethoven innovativ in die Zukunft wirkte: Er nutzte die Form, um Musik prozesshaft umzuformen – und sie so nicht als statische Struktur, sondern als dynamische Transformation zu verstehen.
Statik und Bewegung
Der Gegensatz von Statik und Bewegung scheint das mal voraneilende, dann wieder beinahe stillstehende Scherzo zu bestimmen. Der dritte Satz ist mit »Marcia funebre sulla morte d’un eroe« überschrieben: ein düster schreitender Trauermarsch, der dem Gedenken an einen »Helden« gewidmet ist. Im Mittelteil imitieren anschwellende Tonwiederholungen einen Trommelwirbel. Einen starken Kontrast zu dieser erhabenen Musik stellt das Finale dar. Die motorische Energie des fast durchlaufenden Motivs in kurzen Notenwerten erschöpft sich erst in den letzten, wie austrudelnden Takten.

Klaviersonate Nr. 10
Zahlen und Fakten: Beethoven, Klaviersonate Nr. 10 G-Dur op. 14/2
Komponiert: 1798/99
Gewidmet: Josefa von Braun, Klavierschülerin Beethovens
Rhythmischer Witz
Der erste Satz aus Beethovens zehnter Sonate ist ein Beispiel für die Lust des Komponisten, sein Publikum rhythmisch in die Irre zu führen. Denn das anmutig fließende erste Thema wird auf dem dritten Taktschlag betont – statt auf dem ersten, wie es sich eigentlich gehört. Das führt bereits im vierten, nun ›richtig‹ betonten Takt zu einer leichten Irritation und in der Schlusspassage des Satzes zu einer geistreichen Pointe.
Der hier noch eher versteckte Humor tritt im Mittelsatz offener und im Finale dann ganz deutlich hervor. Das Thema des als Variationen-Folge gestalteten Andante wechselt zwischen kurzen und gebundenen Tönen. Die erste Variation zeigt das Thema in witzig springender Gestalt. Der letzte Abschnitt schließlich scheint im Pianissimo zu verstummen – bevor ein donnernder Schlussakkord die Zuhörenden aufschreckt.
Laut und leise, falsch und richtig
Der Pianissimo-Schluss wird dann im Finale nachgeliefert. Beethoven spielt dort raffiniert mit dem Gegeneinander von Zweier- und Dreier-Rhythmen, lässt schnelle Bewegungen ins Leere sausen, setzt überraschende Akzente oder verirrt sich in ›falsche‹ Tonarten. Aus traditioneller Sicht sollte ein Werk auch nicht mit einem Scherzo-Satz enden. Auch deshalb darf man vermuten, dass der Humor hier Programm ist.

Klaviersonate Nr. 28
Zahlen und Fakten: Beethoven, Klaviersonate Nr. 28 A-Dur op. 101
Komponiert: (1813?–)1816
Gewidmet: Dorothea von Ertmann, Klavierschülerin Beethovens
Unendliche Melodie
Richard Wagner erklärte, der erste Satz von Beethovens Sonate op. 101 sei »so recht ein Beispiel von dem, was ich unter unendlicher Melodie verstehe«. So hat es Wagners Frau Cosima im Tagebuch festgehalten. Das erste Thema des Werks demonstriert die Kunst eines immer nur scheinbaren Endens. Weil die Phrasenschlüsse der Melodie harmonisch offen bleiben, sind auch die Pausen von Spannung erfüllt. Wenn schließlich doch die gesuchte Tonart erreicht ist, folgt eine Passage des Nachsinnens, an deren Ende die rhythmische Ordnung zu verschwimmen scheint. In starkem Kontrast zur lyrischen, meditativen Atmosphäre des ersten Satzes signalisiert der zweite mit seinem insistierenden Rhythmus Aufbruchsstimmung.
Form und Freiheit
Die A-Dur-Sonate wird auch deshalb Beethovens Spätwerk zugerechnet, weil der Komponist im Umgang mit den überlieferten Formen der Tradition eine neue Freiheit gewonnen hatte. Am Ende des dritten Satzes erklingt wie eine Erscheinung das tastende Thema des ersten Satzes. Damit leitet Beethoven zum Finale über, in dem er ein Feuerwerk der Kompositions- und Spieltechniken entfacht. Er greift dabei passagenweise auf die barocke Form der Fuge zurück, die in späteren Werken – zum Beispiel in der »Hammerklaviersonate« – eine wichtige Rolle spielen wird.
Widmungsträgerin
Die exorbitanten Schwierigkeiten der Sonate verweisen auf die offenbar außerordentlichen Fähigkeiten von Beethovens Schülerin Dorothea von Ertmann, der die Sonate gewidmet ist. Sie hat mit ihrem Spiel noch Jahre nach dem Tod ihres Lehrers Komponisten wie Felix Mendelssohn Bartholdy stark beeindruckt.
Benedikt von Bernstorff
Interview

Fabian Müller
im InterviewDie Klaviersonate in A-Dur op. 101 wird oft als Beginn des Spätwerks im Sonatenschaffen Beethovens wahrgenommen. Sehen Sie das auch so?
Fabian Müller: Die Frage ist schwer zu beantworten, denn man könnte auch sagen, dass das Spätwerk schon früher beginnt. Aber bei Opus 101 merkt man gleich zu Beginn des ersten Satzes tatsächlich: Das ist pianistisch und satztechnisch keine klassische Sonate mehr. Beethoven zeigt sich hier als Denker, Visionär und Geschichtenerzähler.
Wegen der ungewöhnlichen Abfolge der Sätze könnte man auf eine Verwandtschaft der A-Dur- mit der zwölften Sonate schließen, die Sie in diesem Konzert ebenfalls spielen. Beide enthalten zudem einen marschartigen Satz.
Und auch bei der Sonate Nr. 12 könnte man an eine Geschichte denken: Sie beginnt mit einem wunderbar beseelten Variationen-Satz. Im Mittelteil des Marsches hört man einen Trommelwirbel. Der letzte Satz ist nicht nach der Schablone eines funktionierenden Finales gestaltet, sondern von einem versteckten Vergnügen erfüllt. Und am Ende verschwindet die Musik ganz unauffällig.
Sie sprechen sehr bildhaft über Beethovens Musik. Kommen Ihnen solche Assoziationen in den Konzerten?
Konzerte sind für mich eher emotionale Erfahrungen, für die ich dann später versuche, Worte zu finden.
Sie spielen vor jeder Sonate eine selbst komponierte Bagatelle als Prolog. Wie kam es zu dieser Idee? Und welche Art von Musik dürfen wir erwarten?
Es war mir wichtig, dem Zyklus etwas Eigenes von mir zu geben und so die Reise durch diese Werke noch persönlicher zu gestalten. Ich liebe die Idee des weißen Blatts und ich mag es, wenn das Publikum nicht genau weiß, was als Nächstes kommt. Die Form der Bagatelle [der Begriff kommt vom französischen Wort für ›Kleinigkeit‹] erlaubt es, mit der Doppeldeutigkeit zwischen scheinbarer Belanglosigkeit und tieferer Bedeutung zu spielen. Ich verstehe meine Bagatellen als eine Art von ›Präludien‹ oder ›Vorworten‹. Manchmal sind sie durch direkte Zitate nah an der betreffenden Sonate, manchmal bilden sie einen Kontrast oder reflektieren die Atmosphäre von Beethovens Werk.
Wir danken den Mitgliedern des Freundeskreises
PATRON
Founding members Arndt and Helmut Andreas Hartwig (Bonn)
PLATINUM
Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)
Godesberg Gastronomie & Event GmbH
Olaf Wegner (Bad Honnef)
Wohnbau GmbH (Bonn)
GOLD
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)
Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)
Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)
Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)
SILVER
Bernd Böcking (Wachtberg)
Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)
Dr. Helga Hauck (Wachtberg)
Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)
Dr. Luciano und Ulrike Pizzulli (Bonn)
Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)
ON THE RECOMMENDATION of our patrons Arndt and Helmut Andreas Hartwig
Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama
BRONZE
Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Heike Fischer und Carlo Fischer-Peitz (Königswinter) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Prof. Ingeborg Henzler und Dr. Mathias Jung (Bendorf-Sayn) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Matthiaß-Küster und Norbert Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)
Biografie
Fabian Müller
BiografieDer gebürtige Bonner Fabian Müller hat sich in den vergangenen Spielzeiten als einer der bemerkenswertesten Pianist:innen seiner Generation etabliert. Für großes Aufsehen sorgte er 2017 beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb in München, bei dem er gleich fünf Preise erhielt. Seither entwickelt sich seine Konzerttätigkeit auf hohem Niveau: 2018 gab er mit dem Bayerischen Staatsorchester sein Debüt in der New Yorker Carnegie Hall und trat erstmals in der Elbphilharmonie auf. In der vergangenen Saison führte er auf Einladung von Daniel Barenboim sämtliche Klaviersonaten Beethovens im Berliner Pierre Boulez Saal auf und begann den Zyklus ebenso beim Beethovenfest Bonn.
Fabian Müller musiziert regelmäßig mit bedeutenden Klangkörpern wie dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Seine rege Beschäftigung mit der Musik Johann Sebastian Bachs spiegelt sich unter anderem in einer längerfristig angelegten Zusammenarbeit mit den Berliner Barock-Solisten, einem Ensemble der Berliner Philharmoniker. Beim Rheingau Musik Festival führt er seit dem vergangenen Sommer, verteilt auf mehrere Jahre, sämtliche Klavierkonzerte Mozarts auf, die er vom Klavier aus leitet.
Auf der Suche nach seinem eigenen Klangideal gründete er außerdem sein eigenes Kammerorchester: The Trinity Sinfonia. Das Ensemble debütierte 2023 beim Rheingau Musik Festival; mit ihm führt er als Dirigent ab 2024 sämtliche Sinfonien Beethovens beim Bonner Beethovenfest auf.
Neben seiner Konzerttätigkeit engagiert sich Fabian Müller im Bereich der Musikvermittlung. Im Rahmen des Klavier-Festivals Ruhr arbeitet er jedes Jahr mit mehr als 300 Kindern zusammen, die sich auf schöpferische Weise mit moderner Musik auseinandersetzen. Dieses Projekt wurde 2014 mit dem Junge-Ohren-Preis und 2016 mit einem ECHO Klassik ausgezeichnet.
Fabian Müller verbindet eine exklusive Zusammenarbeit mit dem Label Berlin Classics. Seine erste CD erschien im Herbst 2018 und enthält Soloklavierwerke von Johannes Brahms. 2020 wurde dort eine weitere CD mit Werken von Beethoven, Schumann, Brahms und Rihm veröffentlicht. Im Frühjahr 2022 folgte sein drittes Album, das die drei letzten Sonaten Schuberts beinhaltet. Darüber hinaus erschien bei der Deutschen Grammophon ein Mozart-Album, das er zusammen mit Albrecht Mayer einspielte.
Dem Beethovenfest in seiner Heimatstadt ist Fabian Müller tief verbunden: Durch seine Beethovensonaten-Konzertreihen und als erster Vorsitzender des Freundeskreises Beethovenfest Bonn e. V.
Konzerttipps
Fabian Müller
Der Beethoven-Zyklus im Festival 2025Awareness
Awareness
Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.
Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.
Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).
Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.
Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.
Programmheftredaktion:
Sarah Avischag Müller
Julia Grabe
Die Texte von Benedikt von Bernstorff sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.