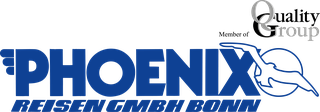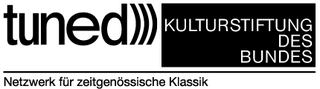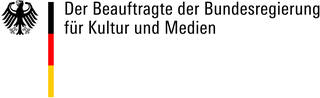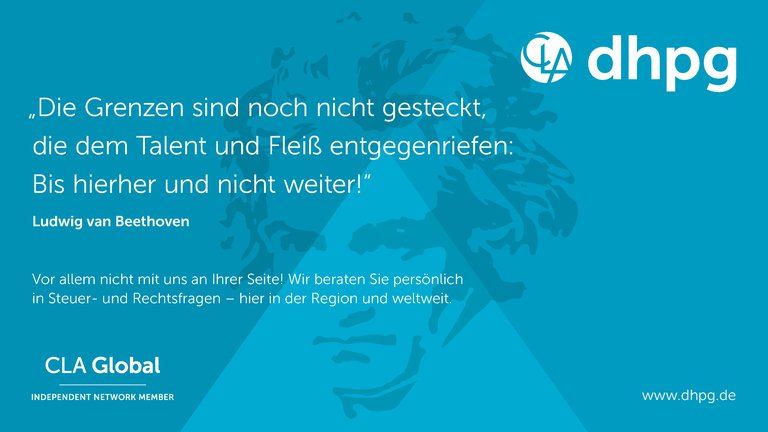The residency of brilliant cellist Anastasia Kobekina’s opens with probably the twentieth century’s most important cello concerto, that of Dmitri Shostakovich: caustic, harrowing, with breakneck frenzy. Plus a world-class orchestra and conductor!
Sat. 6.9.2025
19:30, Opera Bonn
Anastasia Kobekina & Mahler Chamber Orchestra
- Orchestra
- Past Event
- € 105 / 85 / 65 / 45 / 25
Contributors
- Mahler Chamber Orchestra
- Anastasia Kobekina cello
- Maxim Emelyanychev conductor
Programme
Symphony No. 20 in D Major, KV 133
Cello Concerto No. 1 in E-flat Major, op. 107
Symphony No. 5 in E Minor, op. 64
18:45, Bonn Opera, Foyer
Pre-concert talk (in German) with Dr. Beate Angelika Kraus and Liisa Ketomäki (CEO of MCO)
The concert at a glance
What can I expect?
What does it sound like?
Visit our Pleasure Garden
A green retreat awaits you on the top outdoor terrace of the Bonn Opera House. The Pleasure Garden, with its view of the Rhine and the Siebengebirge mountains, is open before, during, and after concerts and invites you to enjoy pleasant conversations and a relaxing stay.
Beethovenfest merch
Description
Two young stars of the classical music scene and a world-class orchestra, plus Tchaikovsky’s most popular symphony, Mozart’s sunny Twentieth, and Shostakovich’s haunting Cello Concerto: all the ingredients needed for a perfect concert. We are eagerly looking forward to the start of a brilliant residency with cellist Anastasia Kobekina as well as the Beethovenfest debut of conductor Maxim Emelyanychev!
Magazine
All articles
Digital programme booklet (in German)
Sat. 6.9.
19:30, Opera Bonn
Anastasia Kobekina & Mahler Chamber Orchestra
Mitwirkende
Mahler Chamber Orchestra
Anastasia Kobekina Violoncello
(Beethovenfest Residenz)
Maxim Emelyanychev Dirigent
Programm
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Sinfonie Nr. 20 D-Dur KV 133
I. Allegro
II. Andante
III. Menuetto e Trio
IV. Allegro
Dmitri Schostakowitsch (1906–1975)
Cellokonzert Nr. 1 Es-Dur op. 107
I. Allegretto
II. Moderato
III. Cadenza
IV. Allegro con moto
Pause
Peter Tschaikowsky (1840–1893)
Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64
I. Andante – Allegro con anima
II. Andante cantabile con alcuna licenza
III. Valse. Allegro moderato
IV. Finale. Andante maestoso – Allegro vivace
Über den Konzertabend
Konzertdauer: ca. 140 Minuten
Gastronomisches Angebot vor Ort
Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.
Für ein ungestörtes Konzerterlebnis bitten wir Sie, auf Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.
Konzerteinführung
18.45 Uhr, Oper Bonn, Foyer
Konzerteinführung mit Dr. Beate Angelika Kraus und Gespräch mit Liisa Ketomäki (CEO des MCO)
Wandelgarten
Auf der obersten Außenterrasse der Oper Bonn erwartet Sie ein grünes Refugium. Der Wandelgarten mit Aussicht auf Rhein und Siebengebirge ist vor, während und nach Konzerten geöffnet und lädt zu Gesprächen und genussvollem Aufenthalt ein.
Grußwort
Liebe Musikfreundinnen, liebe Musikfreunde,
»Alles ist jetzt ultra« – was Goethe 1825 als rasanten Wandel beschrieb, klingt heute aktueller denn je. Digitalisierung, KI, globale Vernetzung: Unsere Welt dreht sich schneller, wird komplexer – und bietet zugleich neue Horizonte. Als Bonner Unternehmen mit weltweiter Perspektive wissen wir, wie wertvoll es ist, innezuhalten und sich auf das Wesentliche zu besinnen. Musik schafft genau diesen Raum: für Tiefe, Verbindung und gemeinsames Erleben. Beethoven war selbst ein Grenzgänger, ein Suchender zwischen den Zeiten – »ultra« im besten Sinn.
Wir wünschen Ihnen, liebes Publikum, ein wunderbares Konzert in der Bonner Oper mit Anastasia Kobekina und dem Mahler Chamber Orchestra.
Herzliche Grüße
Johannes Zurnieden
Phoenix Reisen
Gefördert durch
Einleitung
Musik in Ausnahmesituationen
Kann Musik über sich selbst hinauswachsen? Kann sie Autobiografie sein? Wie viel Mensch steckt zwischen den Tönen? Anastasia Kobekina, Maxim Emelyanychev und das Mahler Chamber Orchestra präsentieren mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Dmitri Schostakowitsch und Peter Tschaikowsky klingende Zeugnisse von intensiven Lebensphasen und Ausnahmesituationen.
Mozart ist mit 16 Jahren an der Schwelle zum Erwachsenwerden, als er in Salzburg seine 20. Sinfonie komponiert. Sie ist voller Überraschungen. Ein jugendliches Genie gibt selbstbewusst seine Visitenkarte ab.
»Du musst alles geben«, sagt Anastasia Kobekina über Schostakowitschs erstes Cellokonzert. Eine Abrechnung mit Stalins Schreckensherrschaft? Auf jeden Fall ein Werk, wie ein Kampf des Individuums gegen eine kollektive Übermacht, findet sie.
»Ist es nicht an der Zeit, aufzuhören?«, sinniert Tschaikowsky zwischen depressiver und manischer Phase und notiert zeitgleich über dem ersten Satz seiner fünften Sinfonie: »Völlige Ergebung in das Schicksal.«
Mozart
Zahlen und Fakten: Sinfonie Nr. 20 D-Dur KV 133
Entstehung: Juli 1772 in Salzburg; Uraufführung nicht dokumentiert
Wolfgang Amadeus Mozart: Geboren am 27. Januar 1756 in Salzburg, gestorben am 5. Dezember 1791 in Wien
Mozart wird erwachsen
Jeder Mensch jenseits des 20. Lebensjahrs kann es bestätigen – und Eltern sind sogar doppelt erfahren: Pubertät ist ›ultra‹! Zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt lassen die Hormone oftmals nur einen Atemzug Zeit. Ist das im Leben eines hochbegabten Genies anders? Wohl kaum. Leopold Mozart verfolgte diese Phase seines Sohns mit Sorge. Und er trug Mitschuld daran, dass Wolfgang Amadeus in seinen jungen Jahren schier aus den beengenden Salzburger Mauern ausbrechen wollte. Hat er ihm doch selbst den Horizont geöffnet: Auf gemeinsamen Konzertreisen zeigte er ihm die Welt und entfachte die Liebe zum Musikland Italien in ihm.
Temperament und Selbstbewusstsein
Und so wartete der Jugendliche im Sommer 1772 sehnsüchtig auf die nächste Reise in den Süden, die dann ab Oktober stattfinden sollte. Dass die Salzburger Anstellung als Konzertmeister der Hofkapelle nur eine Zwischenlösung war, da schien sich der 16-Jährige sehr sicher. Dem Vater jedenfalls lag er bereits intensiv in den Ohren mit seiner Überzeugung, »dass Salzburg kein Ort für mein Talent ist«. Dieses Talent bewies er in jenen Monaten eindrucksvoll mit einer Serie von Sinfonien – darunter seine zwanzigste, heute gezählt als KV 133. Ein Werk, das selbstbewusst mit extravagantem Trompetenglanz auftrumpft. Mozart testete, was er sich in dieser Gattung zutrauen konnte. Und das ist eine Menge. Dramatische Kontraste, mutige Form-Experimente, raffinierte Klangwirkungen: Diese strahlende D-Dur-Sinfonie ist hörbar ein Meisterwerk eines jungen Mannes, in dem es kribbelte und brodelte – und der bereit war, seine Umwelt aus der Reserve zu locken.

Schostakowitsch
Zahlen und Fakten: Cellokonzert Nr. 1 Es-Dur op. 107
Entstehung: Vollendet am 20. Juli 1959
Uraufführung: 4. Oktober 1959 im Großen Saal der Leningrader Philharmonie (Leningrader Philharmoniker; Solist: Mstislaw Rostropowitsch)
Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch: Geboren am 25. September 1906 in St. Petersburg, gestorben am 9. August 1975 in Moskau
Musik vom Überleben
Steht Musik in direktem Zusammenhang mit dem Leben der Komponist:innen? Wer, wenn nicht Dmitri Schostakowitsch hätte diese Frage mit einem klaren »Ja« beantwortet. Seine Biografie spannt sich auf zwischen Repressalien, Unterdrückung und dem trotzigen Ankomponieren gegen politische Eiszeiten in der Sowjetunion. Nicht nur einmal stand er direkt unter Beschuss, musste sich wieder und wieder für seine künstlerischen Ansichten rechtfertigen, wurde öffentlich als Volksfeind gebrandmarkt und spürte die reelle Gefahr um Leib und Leben. Mstislaw Rostropowitsch – Cellist, Dissident und Weggefährte Schostakowitschs – wusste um dessen Gemütsverfassung: »›Ja, die Partei und die Regierung sind meine Lehrmeister‹«, habe Schostakowitsch gegenüber der Öffentlichkeit verkündet. »Zu mir persönlich aber sagte er: ›Wissen Sie, hier kann man nicht atmen, hier kann man nicht leben.‹«

Individuum kontra System
»Seine Musik spiegelt seine Zeit und seinen inneren Zustand«, ist auch Anastasia Kobekina überzeugt. Immer sei darin hörbar, »wie man unter Druck, unter Lebensgefahr komponiert«. Schostakowitschs Cellokonzert Nr. 1 ist für sie der »totale Irrsinn«: »Wir lächeln, obwohl wir bald sterben werden.«
Energisch hebt das Werk an, fast trotzig, irgendwie übermütig. Schostakowitsch schrieb das Konzert 1959 für Rostropowitsch und im Rückblick auf einen schweren Lebensabschnitt: die Stalin-Zeit mit ihrer restriktiven Kulturpolitik, ihrer Willkür und ihrer Unmenschlichkeit. Schostakowitsch hatte massiv darunter gelitten. Das Cellokonzert gilt als eines seiner Werke, die mit Stalin und dessen Regime unverhohlen abrechnen. Für Anastasia Kobekina symbolisiert es das Ringen des Individuums mit einem ganzen System: »Du musst alles geben, um gegen die Kraftwellen des Orchesters anzukommen.«
Grimmiger Triumph und Stalins Fratze
Aufwühlende Energie beherrscht besonders die Außensätze. Anders der zweite Satz: Ein gequälter Gesang in hohen Flageolett-Tönen beschwört eine entrückt-bedrückende Stimmung herauf. Kobekina empfindet in dieser Passage eine Leere nach emotionaler Verausgabung: »Man hat alles gegeben, geschrien, so stark, dass man einfach nichts mehr spürt.« Es folgt ein vollkommen in sich gekehrter Monolog des Cellos, der zunehmend in Wahnsinn abgleitet. Abrupt geht es in den letzten Satz. Ein Finale wie eine böse Satire, die mittendrin die Fratze Stalins zeigt: Schostakowitsch zitiert in einer verzerrten Version dessen liebstes Volkslied, das bei keinem Auftritt des Despoten fehlen durfte.

Tschaikowsky
Zahlen und Fakten: Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64
Entstehung: April bis August 1888 in Frolowskoje bei Klin
Uraufführung: 17. November 1888 in St. Petersburg (Orchester der russischen Musikgesellschaft; Leitung: Peter Tschaikowsky)
Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: Geboren am 7. Mai 1840 in Wotkinsk, gestorben am 6. November 1893 in St. Petersburg
Tönendes Seelenbekenntnis
Im Sommer 1888 meinte es das Leben gut mit Peter Tschaikowsky. Noch wenige Monate zuvor klang es auf einer Konzertreise in seinem Tagebuch anders: »Schreiben für wen? Weiterschreiben? Lohnt sich denn das alles noch?« Aber jetzt hatte ihn die Heimat wieder. Gerade war der Komponist auf das Landgut Frolowskoje nahe der Stadt Klin nordwestlich von Moskau gezogen. Hier stellte sich die notwendige Ruhe und Muße für seine schöpferische Tätigkeit endlich wieder ein. »Ich will jetzt tüchtig arbeiten, um mir selbst, aber auch den anderen zu beweisen, dass ich mich noch nicht ausgeschrieben habe«, berichtete er seiner Mäzenin und engen Brieffreundin Nadeshda von Meck und ließ den Worten Taten folgen: Für die Komposition seiner fünften Sinfonie benötigte er nur kurze Zeit.
Zu offen? Zu persönlich?
Trotzdem keimten die Zweifel: »Ist es nicht an der Zeit, aufzuhören? Habe ich meine Phantasie nicht überanstrengt? Ist die Quelle vielleicht schon versiegt?« Und auch an seiner so rasch niedergeschriebenen Fünften, die mit ihrer Melodienseligkeit schnell zu einem seiner beliebtesten Werke avancierte, ließ er später kein gutes Haar: »Nach jeder Aufführung meiner neuen Sinfonie empfinde ich immer stärker, dass dieses Werk mir misslungen ist. Die Sinfonie erscheint mir zu bunt, zu massiv, zu künstlich, zu lang, überhaupt unsympathisch.«
Vielleicht war ihm die Sinfonie einfach zu persönlich geraten und als eine Art öffentliches Seelenbekenntnis bald unangenehm? Das rätselhafte Programm, das er zu ihr notierte, weist jedenfalls ganz unverhohlen auf Gefühlszustände. Zum ersten Satz heißt es: »Introduktion. Völlige Ergebung in das Schicksal oder, was dasselbe ist, in den unergründlichen Ratschluss der Vorsehung. Allegro: Murren, Zweifel, Klagen, Vorwürfe.« Und über dem zweiten Satz, in dem sich zunächst fast bedrohlich die tiefen Streicher äußern, das Horn aber versöhnliche Töne anstimmt, steht die geheimnisvolle Frage: »Soll ich mich dem Glauben in die Arme werfen???«
Schwermut, Glanz und Überschwang
Gleich zu Beginn der getragenen Einleitung stellen die Klarinetten ein düster-sinnendes Motiv vor, das für die ganze Sinfonie zur wiederkehrenden ›Idée fixe‹ wird. Immer wieder wird die Tonfolge zum mahnenden Einwurf und dringt unheilschwanger in andere Themen hinein. Auch den eleganten Walzer des dritten Satzes konterkariert dieses Leitthema. Erst im vierten Satz bricht sich zuversichtliche Stimmung Bahn: Triumphierend in strahlendem E-Dur schließt das Werk in einem beinahe übertriebenen Jubel.
Ilona Schneider

»Warum ich Schostakowitsch und Tschaikowsky mit einer Kammerorchester-Besetzung aufführe? Das entspricht auch der historischen Praxis. Man weiß, dass Tschaikowsky etwa seine großen Opern mit kleinen Orchestern uraufgeführt hat. Und ich bin sehr glücklich, das mit dem Mahler Chamber Orchestra tun zu können – es ist eine unglaubliche Gruppe von Musiker:innen.«
– Dirigent Maxim Emelyanychev
Interview
Anastasia Kobekina
im Interview
Was macht Schostakowitschs Cellokonzert Nr. 1 »ultra«?
Es ist das Spektrum menschlicher Emotionen, das sich darin auf intensivste Weise entfaltet. Das Individuum, repräsentiert durch das Solo-Cello, sieht sich konfrontiert mit der seelenlosen Maschinerie des Systems, verkörpert durch das Orchester. Für mich steckt darin etwas ultra Expressives. Die Gefühlspalette reicht von größter Tragik bis zu extremem Sarkasmus. Und die Klangpalette erst: Knirschendes Metall, schneidende Töne und Schreie aus tiefstem Herzen.
Welche Relevanz hat dieses Werk im Jahr 2025?
Auch heute blühen Diktaturen, die den Einzelnen und seine Freiheit unterdrücken. Schostakowitschs Musik spiegelt seine Zeit wider, könnte aber in dieser Hinsicht für unsere Gegenwart nicht relevanter sein.
»Aber alles, mein Teuerster, ist jetzt ultra«, schrieb Goethe an den befreundeten Carl Friedrich Zelter. Was ist heutzutage »ultra«?
Alles ist ultra-schnell. Entscheidungen zu treffen, ist ultra. Es gibt ultra-viele Möglichkeiten und ultrawenig Zeit. Deshalb ist die Ultra-Herausforderung auf dieser rasanten Lebensautobahn zu lernen, sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren.
Wir danken den Mitgliedern des Freundeskreises!
PATRON
Founding members Arndt and Helmut Andreas Hartwig (Bonn)
PLATINUM
Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)
Godesberg Gastronomie & Event GmbH
Olaf Wegner (Bad Honnef)
Wohnbau GmbH (Bonn)
GOLD
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)
Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)
Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)
Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)
SILVER
Bernd Böcking (Wachtberg)
Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)
Dr. Helga Hauck (Wachtberg)
Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)
Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)
ON THE RECOMMENDATION of our patrons Arndt and Helmut Andreas Hartwig
Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama
BRONZE
Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Heike Fischer und Carlo Fischer-Peitz (Königswinter) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Prof. Ingeborg Henzler und Dr. Mathias Jung (Bendorf-Sayn) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Matthiaß-Küster und Norbert Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Silke und Andreas Tiggemann (Alfter) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)
Biografien
Anastasia Kobekina, Violoncello
Als »konkurrenzlose Musikerin« von Le Figaro beschrieben, ist Anastasia Kobekina für ihre atemberaubende Musikalität und Technik, ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit und ihre ansteckende Persönlichkeit bekannt. Mit einem breiten Repertoire auf modernen und historischen Instrumenten hat sie sich als eine der aufregendsten Cellist:innen der jüngeren Generation etabliert. Sie trat mit weltweit renommierten Orchestern auf, wie den BBC Philharmonic, Kremerata Baltica und dem Kammerorchester Basel. Sie arbeitete mit Dirigent:innen wie Krzysztov Penderecki, Omer Meir Wellber und Charles Dutoit. Außerdem gewann sie die Bronzemedaille beim Internationalen Tschaikowsky Wettbewerb (2019), den Borletti-Buitoni Trust Award (2022) und war BBC New Generation Artist.
Im russischen Jekaterinburg geboren, erhielt sie ihren ersten Cellounterricht im Alter von vier Jahren. Nach ihrem Abschluss am Moskauer Konservatorium studierte sie weiter an der Kronberg Akademie, der Universität der Künste in Berlin und am Konservatorium von Paris. Derzeit absolviert sie ein Aufbaustudium an der Frankfurter Hochschule (Barockvioloncello).
Maxim Emelyanychev, Dirigent
Der Dirigent und Pianist Maxim Emelyanychev wurde 1988 geboren und studierte am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium. Seit 2013 ist er Chefdirigent des italienischen Originalklang-Ensembles Il Pomo d’Oro. Drei Programme des Ensembles mit der renommierten Sopranistin Joyce DiDonato sind auf CD erschienen. 2019 wurde Emelyanchyev Chefdirigent des Scottish Chamber Orchestra, mit dem er mittlerweile neben Schuberts »großer« C-Dur-Sinfonie auch Mendelssohns Sinfonien Nr. 3 und Nr. 5 eingespielt hat. Sein Vertrag wurde unlängst bis 2028 verlängert.
Als Gastdirigent debütierte Emelyanychev beim Glyndebourne Festival, am Royal Opera House in London, beim Orchestre de Paris, beim London Philharmonic Orchestra, beim Mahler Chamber Orchestra, beim Orchestra of the Age of Enligthenment, beim Koninklijk Concertgebouworkest und bei den Berliner Philharmonikern. Highlights der aktuellen Spielzeit sind die Debüts beim City of Birmingham Symphony Orchestra und bei den Salzburger Festspielen. Ein wichtiges Projekt für die kommenden Jahre ist die Gesamteinspielung aller Mozart-Sinfonien mit Il Pomo d’Oro.
Mahler Chamber Orchestra

Seit seiner Gründung 1997 hat sich das Mahler Chamber Orchestra (MCO) als eines der weltweit besten Kammerorchester international etabliert. Zu den Projekten kommen die etwa 25 Nationen angehörigen Musiker:innen jeweils aus der ganzen Welt zusammen. Das kammermusikalische Zusammenspiel prägt den Klang des Orchesters. 2024/25 standen Konzerte mit Antonello Manacorda, Gianandrea Noseda, Elim Chan und Raphaël Pichon auf dem Programm.
Gerne spielt das MCO ohne Dirigent:in, wobei der jeweilige Solist oder die Solistin das Ensemble vom Instrument aus leitet. Häufig arbeitet das Orchester so mit seinen »Künstlerischen Partnerinnen« Yuja Wang und Mitsuko Uchida zusammen, mit denen es jährlich mehrmals auf Tournee geht. Regelmäßig ist das MCO zu Residenzen in Berlin, Salzburg und Luzern zu Gast; ab 2026 tritt es die Nachfolge der Berliner Philharmoniker bei den Osterfestspielen Baden-Baden an. 2024 hat das Orchester die künstlerische Leitung der Musikwoche Hitzacker übernommen.
Mahler Chamber Orchestra, Besetzung
Violine I
Cindy Albracht (Niederlande), Konstanze Glander (Deutschland), Lily Higson-Spence (Australien), May Kunstovny (Österreich), Hwa-Won Rimmer (Deutschland), Clara Scholtes (Deutschland), Francesco Senese (Italien), Matthew Truscott* (UK), Hayley Wolfe (USA)
Violine II
Stephanie Baubin (Österreich), Charlotte Chahuneau (Frankreich), Michiel Commandeur (Niederlande), Christian Heubes (Deutschland), Paulien Holthuis (Niederlande), Johannes Lörstad (Schweden), Josephine Nobach (Deutschland), Naomi Peters (Niederlande), Fjodor Selzer (Deutschland)
Viola
Monika Grimm (Schweiz), Nicolas Louedec (Frankreich), Béatrice Muthelet (Frankreich), Sofie van der Schalie (Niederlande), Frida Siegrist Oliver (Norwegen), Mladen Somborac (Serbien/Kroatien)
Violoncello
Stefan Faludi (Deutschland), Frank-Michael Guthmann (Deutschland), Clara Grünwald (Deutschland), Rahel Krämer (Deutschland), Nika Somborac (Slowenien), Philipp von Steinaecker (Deutschland)
Kontrabass
Luis Cabrera Martin (Spanien), Jakob Hornbachner (Österreich), Alexander Önce (Deutschland), Ertug Torun (Türkei)
Flöte
Laura Pou Cabello (Spanien), Chiara Tonelli (Italien), Paco Varoch (Spanien)
Oboe
Olivier Doise (Frankreich), Sofía Zamora Meseguer (Spanien)
Klarinette
Nicola Jürgensen-Jacobsen (Deutschland), Mariafrancesca Latella (Italien)
Fagott
Mathis Stier (Deutschland), Pierre Gomes da Cunha (Frankreich)
Horn
José Manuel Gonzalez Diego (Spanien), Pablo Marzal (Spanien), Rodrigo Ortiz Serrano (Spanien), Gerard Sanchez Safont (Spanien), Jose Vicente Castelló (Spanien)
Trompete
Florian Kirner (Deutschland), Yael Fiuza Souto (Spanien)
Posaune
Mark Hampson (Spanien), Andreas Klein (Deutschland), Daniel Tellez I Gutierrez (Spanien)
Celesta
Holger Groschopp (Deutschland)
* Konzertmeister
Konzerttipps
Anastasia Kobekina
Die ResidenzAwareness
Awareness
Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.
Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.
Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).
Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.
Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.
Programmheftredaktion:
Sarah Avischag Müller
Julia Grabe
Lektorat:
Heidi Rogge
Die Texte von Ilona Schneider sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.