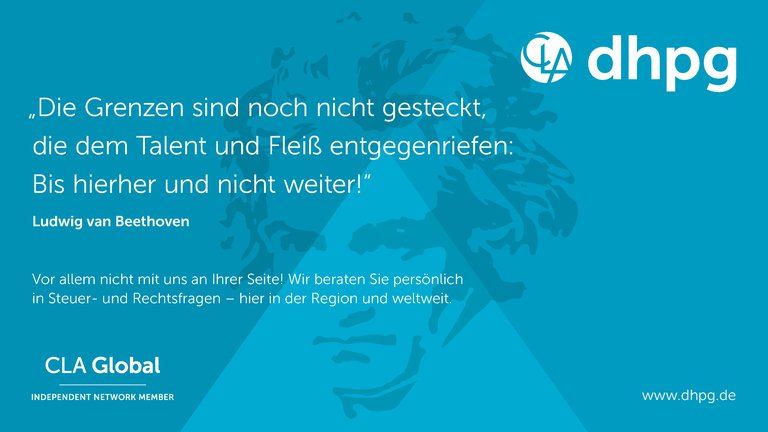Das größte Klaviertrio: Tschaikowskys musikalisches Gedenken für den Pianisten und Gründer des Moskauer Konservatoriums Nikolai Rubinstein, elegisch-episch.
Do 25.9.2025
19.30 Uhr, Beethoven-Haus Bonn
Busch Trio: Tschaikowsky
- Kammermusik
- Vergangene Veranstaltung
- € 48

Mitwirkende
- Busch Trio
- Mathieu van Bellen Violine
- Ori Epstein Violoncello
- Omri Epstein Klavier
Programm
Klaviertrio D-Dur op. 70/1 »Geistertrio«
»Music for Three«
Klaviertrio a-Moll op. 50 »À la mémoire d’un grand artiste«
Auf einen Blick
Was erwartet mich?
Wie klingt das?
Beschreibung
Das Nonplusultra unter den Klaviertrios: Tschaikowskys 45-minütiges Monument für seinen verstorbenen Freund und Mentor Nikolai Rubinstein überwältigt mit einer epischen Wucht und tiefen Traurigkeit. Doch auch die heiteren Seiten des großen russischen Musikers klingen durch. Mit diesem Werk begründete Tschaikowsky die russische Tradition, Klaviertrios für verstorbene Kollegen zu schreiben, wie es später Rachmaninow für ihn tat.
Das Busch Trio mit den Brüdern Epstein und dem Violinvirtuosen Mathieu van Bellen, der mit ganzen Opernadaptionen für die Geige auf sich aufmerksam gemacht hat, begeistert mit souveräner Stilsicherheit – auch in diesem vielseitigen Programm. Sie beginnen mit Beethovens »Geistertrio«, das die Gattung entscheidend prägte. George Walker, der erste afroamerikanische Pulitzer-Preisträger für Musik, schuf 1972 ein Trio, das mit harschen Tonfragmenten ein spannendes Wechselspiel entfaltet.
Konzertmitschnitt durch Deutschlandfunk Kultur
Herunterladen
Weitere Infos

Digitales Programmheft
Do 25.9.
19.30 Uhr, Beethoven-Haus Bonn
Busch Trio: Tschaikowsky
Mitwirkende
Busch Trio
Mathieu van Bellen Violine
Ori Epstein Violoncello
Omri Epstein Klavier
Programm
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Klaviertrio D-Dur op. 70/1 »Geistertrio«
I. Allegro vivace e con brio
II. Largo assai ed espressivo
III. Presto
George Walker (1922–2018)
»Music for Three«
Pause
Peter Tschaikowsky (1840–1893)
Klaviertrio a-Moll op. 50 »À la mémoire d’un grand artiste«
I. Pezzo elegiaco. Moderato assai – Allegro giusto
II.a Tema con variazioni. Andante con moto
II.b Variazione finale e coda. Allegro risoluto e con fuoco – Andante con moto
Über den Konzertabend
Konzertdauer: ca. 100 Minuten
Nach dem Konzert: CD-Verkauf und Signierstunde mit Künstler:innen
Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.
Für ein ungestörtes Konzerterlebnis bitten wir Sie, auf Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.
Einleitung
Von der Klassik über die Romantik zur Moderne: Das Busch Trio macht eine Tour de force durch das goldene Zeitalter der Gattung Klaviertrio. Wenige Jahrzehnte nach seiner Entstehung erreichte das Genre bei Beethoven einen ersten Höhepunkt: Sein »Geistertrio« ist dank seiner dramatischen Gegensätze auf engstem Raum, seiner dichten Durcharbeitung und der den Beteiligten abverlangten konzertanten Brillanz bis heute ein Meilenstein.
Tschaikowskys ausladendes Klaviertrio a-Moll ist demgegenüber ein instrumentales Requiem, in dem die Erschütterung über den plötzlichen Tod eines nahen Freunds nachbebt. Dieser Epitaph-Charakter bedingt auch die originelle Formlösung mit der Verschränkung von zweitem und drittem Satz.
Zwischen diese Traditionswerke schiebt sich George Walkers »Music for Three« von 1971. Ein Stück Hardcore-Avantgarde – fesselnd in seiner Exaltation, seiner hämmernden Unversöhnlichkeit und den Inseln einer melodischen Beruhigung.
Beethoven
Klaviertrio D-Dur op. 70/1
»Geistertrio«Zahlen und Fakten
Komponiert: 1808
Uraufgeführt: 1808 im Privatkonzert bei Gräfin Anna Maria von Erdödy, Wien
Beiname: »Geistertrio«, geprägt von Carl Czerny
Gut zu wissen: Beethoven gilt als Erfinder des modernen Klaviertrios – nach seiner Ankunft in Wien veröffentlicht er 1795 drei Trios op. 1 als ›Visitenkarte‹.
Für Beinamen, die viele musikalische Werke tragen, können sie und ihre Komponist:innen meistens nichts. Bei Beethovens »Geistertrio« verhält es sich jedenfalls so. Die Bezeichnung geht dem Vernehmen nach auf Beethovens Schüler Carl Czerny zurück, der den langsamen Mittelsatz mit einer »Erscheinung aus der Unterwelt« assoziierte. Der fahle Klang der Instrumente, die bebenden Tremolo-Effekte und die starken Kontraste in der Lautstärke mögen ihn dazu angeregt haben – aber als Charakterisierung des kompletten Trios ist der Beiname ungeeignet, er legt eine das Verständnis behindernde, falsche Spur. Das 1808 geschriebene Werk ist vielmehr ein farbenreiches, glänzend-konzertantes, zugleich aber streng durchgearbeitetes Stück Kammermusik. Auch im technischen Anspruch an die Interpret:innen geht es über den Standard hinaus, den die Vorgänger Haydn und Mozart erreicht hatten.
Vor allem ist das Werk aus dramatischen Gegensätzen gefügt, die auf engstem Raum aufeinanderstoßen und so für eine beträchtliche Spannung sorgen. Es beginnt mit einem raketenhaften einstimmigen Anfangsgedanken der drei Instrumente. Doch schon im fünften Takt wird der Schwung durch einen in der Tonart fremd klingenden Einzelton ausgebremst. Nach diesem plötzlichen Innehalten führt Beethoven eine kurze, lyrische Formel ein, die zwischen den Instrumenten hin- und hergereicht wird. Als sogenanntes Seitenthema, der zweitwichtigsten Hauptmelodie in diesem Sonatensatz, folgt eine viertönige, gleichfalls eher gesangliche Figur, die zunächst im Klavier erscheint und dann von den Streichern aufgegriffen wird. Zwar kehrt der energische Satzbeginn nicht wieder, aber dessen Motive sind als Kontrapunkte, also Gegenstimmen, allgegenwärtig. Überhaupt besteht die Satz-Substanz aus wenig mehr als dem Material der ersten acht Takte, das dann aber nach allen Regeln der Kunst aufgespalten und wieder zusammengefügt wird.
Einer ähnlichen Dramaturgie folgt der letzte Satz des Trios, in dem das Hauptthema sowohl durch harmonische Ausweichung als auch einen verweigerten Schlussakkord ausgebremst wird. Diese Brüche führen diesmal allerdings nicht zu einer Wendung ins Lyrische: Der Schlusssatz behält seinen unwiderstehlich-effektvollen Drive und verlangt immense Virtuosität.
Bleibt das düster-verhangene Largo assai ed espressivo. Dieser Zwischensatz steht im äußersten Kontrast zu den Rahmensätzen, auch wenn man die Geister-Assoziationen zurückweist. Beethoven gewinnt die Themen aus dem besonderen Klang der beteiligten Instrumente: das nachdenkliche, langsame Viertel-Motiv aus dem tragenden Ton der Streicher, das mottohafte Sechzehntel-Motiv aus den Klaviertasten-Anschlägen. Im Verlauf setzt ein ›schauriges‹ Tremolo ein: schnell zitternde Akkorde, vor allem im Klavier, die von einer bestimmten Stelle an den kompletten Satz durchziehen. Das Tremolo ist indes kein rein romantischer Stimmungsfaktor, sondern steht in thematischer Beziehung zu den Hauptmotiven. Beethoven blieb auch im »Geistertrio« Klassiker.

Uraufführung bei der Gönnerin
Die Uraufführung des im Sommer 1808 geschriebenen Werks fand im Dezember desselben Jahres im privaten Rahmen statt: im Palais der Widmungsträgerin Gräfin Anna Maria von Erdödy in der Wiener Krugerstraße, wo Beethoven damals auch wohnte. Der Komponist saß selbst am Flügel, die Violine spielte Ignaz Schuppanzigh, das Cello Joseph Linke. Beide Trios des Opus 70 begeisterten sogleich die musikalische Mitwelt. Der Dichter und Komponist E. T. A. Hoffmann besprach sie noch im Folgejahr begeistert in der Leipziger »Allgemeinen musikalischen Zeitung«, rühmte dort, »wie B. den romantischen Geist der Musik tief im Gemüte trägt und mit welcher hohen Genialität, mit welcher Besonnenheit, er damit seine Werke belebt«.
Mit der Gräfin Erdödy überwarf sich der misstrauische und aufbrausende Komponist nur wenige Wochen nach der Uraufführung. Weil er sich von seinem Diener in ihrem Auftrag bespitzelt fühlte, verließ er im Eklat ihr Haus und entzog ihr auch die Widmung der beiden Trios.
Walker
»Music for Three«
Zahlen und Fakten
Komponiert: 1971
Gut zu wissen: George Walker gewann 1996 als erster Afroamerikaner den Pulitzer-Preis für Musik.
Der vielfach ausgezeichnete afroamerikanische Pianist, Komponist und Hochschullehrer George Walker gehört in den USA zu den angesehensten Musiker:innen seiner Generation. In Europa ist er bis heute weniger bekannt – was erstaunlich ist, weil er dank seiner illustren Lehrer:innen – Rudolf Serkin, Robert Casadesus, Nadia Boulanger – und seines Studiums in Paris eine starke Verbindung zur europäischen Musiktradition der Moderne hatte, die er mit Einflüssen aus dem Jazz und dem afroamerikanischen Spiritual anreicherte. In »Music for Three« von 1971 sind letztere aber kaum wirksam. Das Stück, das dem Titel zufolge schlicht die Besetzung zu seinem Gegenstand zu machen scheint, ist, wenn man so will, europäische Hardcore-Avantgarde pur. In seiner unversöhnlichen Atonalität ist mehr als nur eine Spur der Schönberg-Schule hörbar.
Wiederholte sturzbachartige Einsätze des Klaviers, auf einander komplex überlagernde Rhythmen verteilt, wechseln mit Repetitionsmotiven, vorzugsweise in den Streichern, Clusterbildungen und – ja, auch das – zaghaft erklingenden Melodie-Fragmenten ab. Trotz oder auch gerade wegen seiner einsätzigen Kürze ist das ein dichtes, aufregendes, in der Intensität seiner Klangereignisse in Bann schlagendes Stück moderner Kammermusik.

Tschaikowsky
Klaviertrio a-Moll op. 50
»À la mémoire d’un grand artiste«Zahlen und Fakten
Komponiert: Winter 1881/82 in Rom
Uraufgeführt: 30. Oktober 1882 in Moskau durch Sergey Taneyev (Klavier), Iosef Hřmalý (Violine) und Wilhelm Fitzenhagen (Cello) in der Russischen Musikgesellschaft
Widmung: Nikolai Rubinstein, verstorben 1881
Tschaikowskys Klaviertrio steht mit Blick auf sein Gesamt-Œuvre als Solitär da. Es ist das einzige Werk in dieser Gattung, das er komponierte. Mit mehr als 45 Minuten Spieldauer übertrifft es die allermeisten seiner Schwesterwerke bei weitem, und einzigartig dürfte auch die hier realisierte Form-Idee sein.
Tschaikowsky war von Haus aus kein Freund des Klaviertrios. Seine Ohren vertrügen die Verbindung von Klavier, Violine und Cello nicht, ließ er gegenüber seiner Gönnerin Nadeschda von Meck verlauten. Ein trauriger äußerer Anlass brachte ihn dazu, diese Abneigung zu überwinden: Im Frühjahr 1881 war überraschend der Pianist Nikolai Rubinstein gestorben, der Tschaikowsky 15 Jahre zuvor als Lehrer an das von ihm gegründete Moskauer Konservatorium geholt hatte. Die pathetische Widmung »À la mémoire d’un grand artiste« weist das Klaviertrio als klingendes Epitaph aus. Die Verbindung von kompositorischer Meisterschaft und spürbarer emotionaler Erschütterung führt zu einem Höhepunkt romantischer Kammermusik.
Der knapp 20 Minuten dauernde erste Satz, das »Pezzo elegiaco«, prägt mit seinem Hell-Dunkel, seinen Kontrasten von Trauer und Trost, Auflehnung und Erschöpfung den Charakter des Werks als Requiem. Er beginnt wie ein »Lied ohne Worte«, wobei die schier unendliche Melodie, die das Cello anstimmt und die Violine fortführt, an eine melancholische russische Volksweise erinnert. Nach einer Überleitung lässt das kontrastive Seitenthema (in Dur) energischere, frischere, ja im akkordischen Choralsatz des Klaviers nahezu heroische Töne aufklingen – als wolle die Musik die Gestalt des Verstorbenen noch einmal ins Leben zurückholen. Im Satzverlauf kommt es dann aber wiederholt zu Stockungen und Quasi-Stillständen, und die lange Coda verklingt und versinkt gleichsam im Keller.
Völlig aus dem Rahmen der seinerzeit geläufigen Formlösungen fällt die zweite Hälfte des Trios. Als zweiter Satz folgt ein Andante mit zunächst elf Variationen. Eine (das Thema rhythmisch stark verändernde) zwölfte Variation eröffnet, im Sinne einer überlappenden Verschränkung, zugleich das Finale. Erst am Ende fährt das Werk in den Hafen seiner Ausgangstonart a-Moll ein, in der schließlich als zyklischer Abschluss das Elegie-Thema des ersten Satzes erneut erklingt. Es verdämmert dann über dem Trauermarsch-Rhythmus des Klaviers.
Diese Rückwendung scheint auch dringend geboten, denn zuvor verliert sich der Trauerton auf weite Strecken: Die schwermütige Liedmelodie des Beginns etwa wird im Laufe der Variationen zum eleganten Walzer, zur Chopin-nahen Mazurka und zu einer mit allen erdenklichen Künsten gespickten Fuge. Aber auch das Finale zeichnet sich auf weite Strecken durch muntere konzertante Brillanz und durch temperamentvolle Steigerungseffekte aus. Es scheint, als rufe die Musik zentrale Lebensmotive Rubinsteins in Erinnerung. Die Fuge zum Beispiel mag an seine Rolle als Gründer des Moskauer Konservatoriums erinnern, das schließlich nicht zuletzt auch ein Hort akademischer ›Gelehrtheit‹ war.
Klaviertrios als Epitaphe
Mit der Widmung »À la mémoire d’un grand artiste« steht das Werk in einer langen Reihe instrumentaler Trauer- und Gedächtnismusiken, die von Beethovens »Mondscheinsonate« und dem zweiten Satz der »Eroica« bis zu Alban Bergs Violinkonzert reicht. Tschaikowsky begründete damit die Tradition unter russischen Komponist:innen, Klaviertrios zum Andenken an verstorbene Kolleg:innen zu schreiben. Nach ihm taten das etwa Sergei Rachmaninow (auf Tschaikowskys Tod), Anton Arensky und Dmitri Schostakowitsch.
Markus Schwering
Biografie
Busch Trio

Begegnungen in der Welt der Kammermusik führen oft zu Freundschaften, doch umgekehrt ist es weitaus ungewöhnlicher: wenn aus einer Gruppe von Schulfreunden mit unterschiedlichen Hobbys ein Kammermusikensemble entsteht, das eine internationale Bühnenkarriere erreicht. So entstand das Busch Trio, das sich als eines der führenden Ensembles etabliert hat. »Dieses Trio ist die Frucht einer langjährigen Freundschaft«, beschreibt Omri Epstein den im Wesentlichen spontanen Prozess, durch den das Trio entstand, nachdem sich die drei vor mehr als einem Jahrzehnt am Royal College of Music in London kennengelernt hatten. Damals waren sie angehende Solisten, doch ihre gemeinsame Leidenschaft für Kammermusik wurde zu ihrer stärksten Verbindung.
Zu dieser Zeit erhielt der Violinist des Trios Mathieu van Bellen die Ehre, auf der »ex-Adolf Busch« G. B. Guadagnini (Turin, 1783) zu spielen – der legendäre Geiger Adolf Busch war schon damals ein leuchtendes Vorbild für das junge Trio. Ihre Entscheidung, auf Darmsaiten zu spielen, zeigt eine tiefe Wertschätzung für die Ästhetik der großen Musiker:innen des frühen 20. Jahrhunderts.
Heute tritt das Busch Trio regelmäßig auf bedeutenden Bühnen und Festivals in Europa und den USA auf. Es wurde von The Gramophone als »eine wahre Freude von Anfang bis Ende« beschrieben und von der Süddeutschen Zeitung als »das führende Klaviertrio seiner Generation«.
Das Trio wurde für seine Konzerte und Aufnahmen hochgelobt und erhielt bedeutende Auszeichnungen und Preise in den Niederlanden, Großbritannien, Deutschland, Belgien und Frankreich. Das Plattenlabel Alpha Classics hat dem Ensemble sein Vertrauen geschenkt, indem es ihm bereits frühzeitig eine langfristige Zusammenarbeit anbot. Gemeinsam haben sie bedeutende Aufnahmen veröffentlicht, darunter sämtliche Werke von Dvořák auf vier CDs, die kompletten Trios und das »Forellenquintett« von Schubert auf zwei CDs sowie eine kürzlich erschienene Aufnahme mit Werken von Ravel und Schostakowitsch. Die Zukunft dieser erfolgreichen Zusammenarbeit umfasst die Aufnahme aller Trios von Beethoven, die in den kommenden Jahren auf fünf CDs veröffentlicht werden sollen.
Wir danken den Mitgliedern des Freundeskreises
MÄZEN
Gründungsmitglieder Arndt und Helmut Andreas Hartwig (Bonn)
PLATIN
Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)
Godesberg Gastronomie & Event GmbH
Olaf Wegner (Bad Honnef)
Wohnbau GmbH (Bonn)
GOLD
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)
Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)
Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)
Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)
SILBER
Bernd Böcking (Wachtberg)
Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)
Dr. Helga Hauck (Wachtberg)
Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)
Dr. Luciano und Ulrike Pizzulli (Bonn)
Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)
AUF EMPFEHLUNG unserer Mäzene Arndt und Helmut Andreas Hartwig
Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama
BRONZE
Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Heike Fischer und Carlo Fischer-Peitz (Königswinter) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Prof. Ingeborg Henzler und Dr. Mathias Jung (Bendorf-Sayn) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Matthiaß-Küster und Norbert Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)
Konzerttipps
Mehr Kammermusik
im BeethovenfestAwareness
Awareness
Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.
Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.
Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).
Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.
Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.
Programmheftredaktion:
Sarah Avischag Müller
Julia Grabe
Die Texte von Markus Schwering sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.