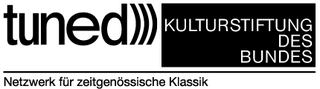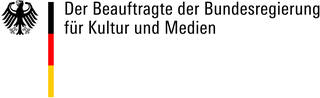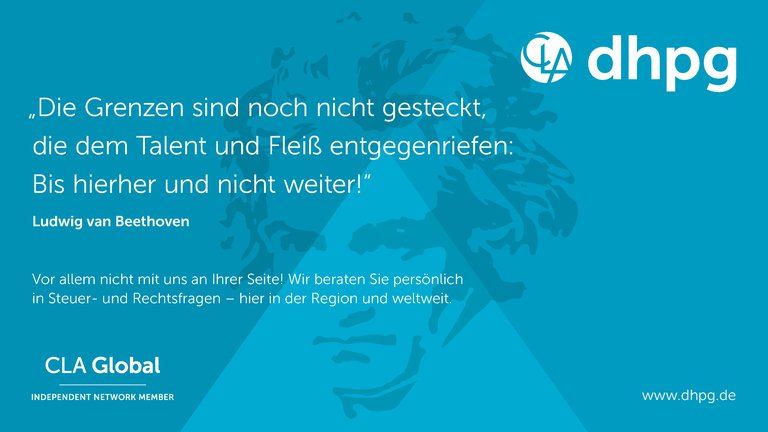Ein international erfolgreiches Klaviertrio mit Wurzeln in Rheinbach zeigt, wie Beethovens Sinfonik in Dreierbesetzung aufblüht – kombiniert mit zwei tiefsinnigen, unbekannten Werken von Lili Boulanger und Anton Arensky.
Do 11.9.2025
19.30 Uhr, Stadttheater Rheinbach
Trio Orelon: Symphonie en miniature
- Kammermusik
- Vergangene Veranstaltung
- € 28 / 18

Mitwirkende
- Trio Orelon
- Judith Stapf Violine
- Arnau Rovira i Bascompte Violoncello
- Marco Sanna Klavier
Programm
»Deux pièces en trio«
Klaviertrio Nr. 1 d-Moll op. 32
Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 36, Fassung für Klaviertrio vom Komponisten
Auf einen Blick
Was erwartet mich?
Wie klingt das?
Beschreibung
Man nannte sie ein Jahrhunderttalent der Komposition, und schon mit neun Jahren begann Lili Boulanger zu komponieren. In ihrem kurzen Leben schuf sie Musik von betörender Tiefe und Leichtigkeit. 1918, kurz vor ihrem Tod, schrieb sie im Krankenbett zwei Stücke für Klaviertrio: eindringliche Zeugnisse einer sensiblen Seele im Angesicht des Krieges und der eigenen Vergänglichkeit. Auch Arenskys großes Klaviertrio erhebt einen Klagegesang. Im russisch-romantischen Tonfall scheint das Stück von einem unendlich weiten Atem getragen.
Mit dieser ersten Konzerthälfte beginnt das Trio Orelon um die aus Rheinbach stammende Geigerin Judith Stapf das letzte der drei »Symphonie en miniature«-Konzerte im Rhein-Sieg-Kreis. Den beiden erschütternden Trios setzen die drei Musiker:innen Beethovens lichte Sinfonie Nr. 2 entgegen – in einer federleichten Triofassung aus Beethovens eigener Hand. Drei sehr unterschiedliche Werke, die zwischen Ernst und Hoffnung, Nachdenklichkeit und quirliger Lebensfreude pendeln.
Herunterladen
Weitere Infos
Magazin
Alle Beiträge
Digitales Programmheft
Do 11.9.
19.30 Uhr, Stadttheater Rheinbach
Trio Orelon: Symphonie en miniature
Mitwirkende
Trio Orelon
Judith Stapf Violine
Arnau Rovira i Bascompte Violoncello
Marco Sanna Klavier
Nina Kazourian Gesang, Klavier, Gitarre
Programm
Opening Act mit Nina Kazourian
Lili Boulanger (1893–1918)
»Deux pièces en trio«
I. »D’un matin de printemps« (Von einem Frühlingsmorgen)
II. »D’un soir triste« (Von einem traurigen Abend)
Anton Arensky (1861–1906)
Klaviertrio Nr. 1 d-Moll op. 32
I. Allegro moderato
II. Scherzo. Allegro molto
III. Elegia. Adagio.
IV. Finale. Allegro non troppo
Pause
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 36, Fassung für Klaviertrio vom Komponisten
I. Adagio molto – Allegro con brio
II. Larghetto
III. Scherzo. Allegro – Trio
IV. Allegro molto
Über den Konzertabend
Konzertdauer: ca. 140 Minuten
Gastronomisches Angebot vor Ort
Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.
Für ein ungestörtes Konzerterlebnis bitten wir Sie, auf Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.
Grußwort
Liebe Musikinteressierte,
auch im vierten Jahr seiner Intendanz ist es Steven Walter gelungen, sechs ansprechende Konzertprogramme mit herausragenden Künstlerinnen und Künstlern für den Rhein-Sieg-Kreis zu entwickeln. Vom 4. bis zum 26. September 2025 bringt das Beethovenfest wieder exzellente Kammermusik an besonderen Spielorten in Bad Honnef, Hennef, Königswinter, Meckenheim, Rheinbach und Siegburg auf die Bühne. Dabei nimmt das Beethovenfest dieses Jahr auch das junge Publikum aus dem Rhein-Sieg-Kreis mit in den Blick. So finden neben dem Improvisationsprojekt des Stegreif Orchesters im Rhein Sieg Forum begleitende Workshops für Schülerinnen und Schüler statt.
Gerne unterstützt die Kreissparkasse Köln daher nunmehr im 24. Jahr die beliebte Konzertreihe, um möglichst vielen Menschen zu überschaubaren Preisen einen Konzertbesuch zu ermöglichen.
»Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten« – im Sinne dieses Zitats von Aristoteles wünsche ich Ihnen unvergessliche Musikmomente.
Ihr
Alexander Wüerst
Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Köln
Gefördert durch
Einleitung
Die Musik von Lili Boulanger ist von berührender, sonorer Schönheit. Zwei ihrer letzten Werke erzählen vom Frühlingsmorgen und von einem traurigen Abend – mit getupften Klängen, Naturbildern, Trost und stiller Klage. Als Kontrast dazu stürzt uns Anton Arensky mit seinem d-Moll-Klaviertrio in ein Wechselbad der Gefühle: leidenschaftlich, pathetisch – und überraschend humorvoll.
Französischer Feinsinn und russische Emphase treffen auf den experimentellen Beethoven, der seine zweite Sinfonie selbst für Klaviertrio arrangierte. Die »Unplugged«-Version eines Orchesterwerks: überraschend transparent, kammermusikalisch verdichtet – und als Hörerlebnis noch direkter. Drei Trio-Variationen über existenzielle Musik. Zwischen feiner Empfindung, Aufgewühltheit und revolutionärer Energie.
Boulanger
Zahlen und Fakten: Lili Boulanger, »Deux pièces en trio«
Komposition: 1917/18
Uraufführung: Am 8. Februar 1919 im Pariser Salle de la Société des concerts (»D’un matin de printemps«)
Bemerkung: Die »Deux pièces en trio« gehören zu den allerletzten Werken Lili Boulangers. Nach diesen zwei immens lyrischen Stücken komponierte die früh von schweren Krankheiten gezeichnete Boulanger – in Gewissheit ihres baldigen Todes – nur noch wenige geistliche Werke.
Leid und Schrecken nach Leid und Schrecken
Im direkten Anschluss an den Ersten Weltkrieg grassierte 1918 die »Spanische Grippe« in Europa. Nach dem Kriegsschrecken sehnten sich die Menschen nach Ruhe und Sicherheit, doch die Influenza-Pandemie raffte, je nach Schätzung, unfassbare 20 bis 100 Millionen Menschen dahin.
Ein kurzes Leben
Die »Spanische Grippe« war allerdings nicht die Ursache für den frühen Tod von Lili Boulanger. Während ihre ältere Schwester Nadia zu einer der wichtigsten Kompositionslehrer:innen des 20. Jahrhunderts avancierte und erst 1979 mit 92 Jahren hochbetagt starb, war Lili leider nur ein kurzes Leben vergönnt. Vorausgegangen waren eine ganze Reihe von Erkrankungen, darunter eine früh diagnostizierte Bronchialpneumonie sowie Morbus Crohn. Boulanger starb am 15. März 1918 in dem kleinen Ort Mezy-sur-Seine, etwa 35 Kilometer nordwestlich von Paris gelegen, im Alter von 24 Jahren an Tuberkulose.
Ihre Musik
Lili Boulanger wurde als »Wunderkind« gefeiert. Trotz ihres frühen Todes entstanden erstaunlich viele Werke, vor allem solche für diverse Vokalmusik-Besetzungen: Gesang und Klavier, Chor und Klavier, Chor und Orchester und mehr. Boulanger – in der Vorahnung ihres baldigen Ablebens – komponierte gewissermaßen Tag für Tag gegen den Tod an.
Überwundener Winter?
Die »Deux pièces en trio« (Zwei Stücke für Trio) entstanden 1917 und 1918. Damit gehört das zweisätzige Trio zu ihren allerletzten Werken. Mit fast lustigen, leicht ›schrägen‹ Akkorden bereitet das Klavier in »D’un matin de printemps« (»Von einem Frühlingsmorgen«) alleine den ersten Einsatz der Geige vor. Diese hebt sich mit etwas längeren, leicht klagenden Tönen vom Klavier ab. Die Last und die Kälte eines überwundenen Winters müssen zunächst noch abgeschüttelt werden. Das Klavier aber lässt nicht los – und führt im Zusammenspiel mit der Violine einen ersten, ›jauchzenden‹ Höhepunkt herbei. Dann spielt das Cello in seiner Lage das nachdenklich wie heitere Thema; als würde ein Kuckuck traurig singen. Man erinnert sich vielleicht an die Violinsonate von Claude Debussy, ebenfalls 1917 komponiert – und gleichfalls so etwas wie ein ›Schwanengesang‹ von Boulangers französischem Kollegen.
Schwerer Abend
Zu Beginn des zweiten Stückes, das von einem traurigen Abend (»D’un soir triste«) erzählt, beginnt das Klavier erneut alleine. Wir hören ungewöhnliche Akkorde, die trotz der titelgebenden Abendstimmung fast merkwürdig leuchten. Dieses Mal ist das Cello nach wenigen Augenblicken mit dabei. Ein trauriger, völlig in sich versunkener Gesang. Ein starker Gegensatz zu dem ersten Stück vom Frühlingsmorgen: gemischte Gefühle also. Musikwissenschaftler Damien Sagrillo notierte über Boulanger: »Ihre Werke vermitteln im Titel eine eher pessimistische Grundstimmung.« Und, ebenso zu hören in den Kompositionen dieses Konzerts: »Boulangers Tonsprache pendelt zwischen traditionell und avantgardistisch.«

Arensky
Zahlen und Fakten: Anton Arensky, Klaviertrio Nr. 1 d-Moll op. 32
Komposition: 1894
Uraufführung: Wahrscheinlich im Dezember 1894 in Moskau oder Sankt Petersburg in der Besetzung Jan Hřímalý (Violine), Anatoliy Brandukov (Violoncello) und Anton Arensky selbst am Klavier
Bemerkung: Das d-Moll-Klaviertrio steckt voller russischer Leidenschaft, Überschwang und überraschendem Humor. Ein Hauptwerk der russischen Kammermusik Ende des 19. Jahrhunderts.
Beste Voraussetzungen
Anton Arensky, geboren im Sommer 1861 in Nowgorod, stammt aus einer wohlhabenden Familie, in der Musik auf der Tagesordnung stand. Er besuchte zunächst eine Musikschule in Sankt Petersburg und wechselte 1879 für ein Kompositionsstudium bei Nikolai Rimski-Korsakow an das dortige Konservatorium. Der galt als bedeutendster Kompositionslehrer des 19. Jahrhunderts und unterrichtete neben Arensky Berühmtheiten wie Igor Strawinsky, Sergei Prokofjew und Alexander Glasunow.
Ein anderes kurzes Leben
Musikwissenschaftler David Fanning bezeugt jedoch, dass Rimski-Korsakows Stil wenig Einfluss auf seinen Schüler Arensky hatte – und fasst dessen ebenfalls tragisch kurzes Leben kompakt zusammen:
»Obwohl er ein Schüler von Rimski-Korsakow war, geriet Arensky in den Bann Tschaikowskys – sehr zum Ärger seines früheren Lehrers, der schließlich prophezeite, er werde bald in Vergessenheit geraten. Das frühe Leben Arenskys beschrieb Rimski-Korsakow in seinen Memoiren als ›zügellos, zwischen Wein und Kartenspiel zerrinnend‹ und bemerkte, er habe diese Lebensart auch beibehalten, als er 1894 in St. Petersburg Nachfolger von Mili Balakirew als Leiter der Kaiserlichen Kapelle wurde. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend. Im Alter von 44 Jahren starb Arensky an Tuberkulose.«
Urromantisches Trio
Neben drei Opern komponierte Arensky außerdem zwei Sinfonien, ein Klavier- und ein Violinkonzert, Lieder, Chöre, zwei Streichquartette und zwei Klaviertrios. Das erste Trio entstand 1894. Ein urromantisches Stück, das vom Klavier vollmundig zu stolzem Leben erweckt wird (Allegro molto): gebrochene Akkorde, aufgeregte innere Bewegung. Es folgt ein heroisch-leidenschaftliches Hauptthema, gespielt von der Violine. Beim dritten Anheben schraubt sich die Geige schon ein wenig höher als noch zuvor. Und – originell! – Arensky folgt nicht einem ›Standard-Plan‹, wenn nun das Cello mit seiner ersten Ausführung des Hauptthemas dran ist. Nein, die Geige grätscht dem Cello in die Parade, noch bevor dieses überhaupt seinen ersten ›Satz‹ mit Punkt und Komma fertig formuliert hat. Wir spüren die Emphase, das amouröse Brennen dieser Musik.
Überraschung und Humor
Mit dem ›Liebesdrama‹ des ersten Satzes endet das Ganze natürlich nicht. Im zweiten Satz (Scherzo. Allegro molto) beweist Arensky Humor – er lässt die Violine kichern: Der Bogen wird schnell auf die Saiten fallengelassen, so dass ein Klangeffekt aus kurzen Tönen entsteht. Das Cello zupft eine gemächliche Linie nach oben und das Klavier prescht gleich im vierten Takt in überraschender Lautstärke nach unten. Originell und abwechslungsreich!
Fast rastlose Kontraste
Im dritten Satz (Elegia. Adagio) darf nun endlich einmal das Cello anfangen. Gespielt werden soll es mit einem Dämpfer, welcher auf den Steg gesteckt wird. Dadurch wird der Klang weicher, säuselnder, und wirkt wie aus weiter Ferne herübergetragen. Das Klavier unterstützt den Trauermarsch-Charakter mit tiefen Akkorden. Im Mittelteil dagegen leuchtet alles wunderschön; ›wie früher‹, als erinnere sich jemand inmitten der Misere im Hier und Jetzt an amouröse Jugendzeiten, während sich der ›Titelheld‹ im letzten Satz (Finale. Allegro non troppo) anfänglich wieder ganz seinen kämpferischen Ambitionen hingibt. Dabei bleibt es nicht: Arenskys erstes Klaviertrio ist ein Werk der großen emotionalen Kontraste, ein Werk voller Geschichten aus dem Leben eines Menschen, der weiß, was die Präsenz von Liebe – und deren Abwesenheit – mit sich bringen kann.

Beethoven
Zahlen und Fakten: Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 36
Komposition: 1801/02
Uraufführung: Am 5. April 1803 im Theater an der Wien unter Leitung des Komponisten
Bearbeitung für Klaviertrio: Die zweite Sinfonie in der Klaviertrio-Fassung Beethovens entstand wahrscheinlich, weil der Komponist dieses Werk selbst bei Kammermusik-Gelegenheiten erleben wollte. Zugleich erhoffte er sich damit zusätzliches Geld von seinem Verleger.
Eine Sinfonie für Zuhause
Das große Werk im kleinen Rahmen: ein attraktiver Anreiz für Komponist:innen. Zum Beispiel bearbeitete Johannes Brahms seine Sinfonien, um sie zuhause an zwei Klavieren einem kleinen Publikum zu präsentieren. Auch Brahms’ großes Vorbild, Ludwig van Beethoven, hatte offenbar Lust, seine zweite Sinfonie auch in kammermusikalischen Kontexten zu hören.
Pause und Druck
So entstand die Fassung für Klaviertrio der zweiten Sinfonie. Der Schaffensprozess der originalen Orchesterfassung war allerdings nicht ganz ›ungebrochen‹. Im Herbst 1800 brachte Beethoven erste Einfälle zu Papier. Dann sorgte die Arbeit an der Ballettmusik zu »Die Geschöpfe des Prometheus« für eine ›Sinfonie-Pause‹. Von Herbst 1801 bis April 1802 konnte Beethoven sich wieder seiner zweiten Sinfonie zuwenden, und so kam es am 5. April 1803 zur Uraufführung. 1806 erschien schließlich die Trio-Fassung im Druck.
»Bizarr, wild und grell«
Nachdem Beethovens zweite Sinfonie publiziert worden war, stellte 1805 ein Rezensent für sich fest:
»Das Ganze ist zu lang und Einiges überkünstlich; wir setzen hinzu: der allzu häufige Gebrauch aller Blasinstrumente verhindert die Wirkung vieler schöner Stellen und das Finale halten wir, auch jetzt, nach genauer Bekanntschaft, für allzu bizarr, wild und grell.«
Das (vermeintliche) ›Blasinstrumenten-Problem‹ war mittels der Klaviertrio-Fassung naturgemäß aus der Welt geschafft – und der Vorwurf der »Bizarrerie« wurde Beethoven zu Lebzeiten oft gemacht; und zwar immer dann, wenn seine Werke besonders revolutionär, forsch, ja, schlichtweg ›anders‹ tönten. »Bizarr«: ein Lieblingswort der angesichts von Beethovens Musik oft hilflosen Kritiker!
»Gut eingerichtet«
1806 hieß es dann zur vorgelegten Klaviertrio-Fassung der zweiten Sinfonie: »Dieser Auszug ist […] in vielem Betracht mit Dank anzunehmen, so sehr man – und im Ganzen gewiss mit vollkommenem Grunde – gegen das Arrangieren solcher Werke überhaupt sein mag. […] [Man] […] hätte kaum geglaubt, dass davon ein so genügender und zugleich für alle drei Instrumente so gut eingerichteter Auszug gegeben werden könne, als hier, den Hauptsachen nach, wirklich gegeben ist.«
»Ein nicht unwürdiges Bild vom Ganzen«
Das Lob für die gelungene – vom Orchester auf Violine, Violoncello und Klavier übertragene – Instrumentation überbot der anonyme Autor sogar, indem er schrieb: »Man erhält in der Tat ein nicht unwürdiges und möglichst vollständiges Bild vom Ganzen.« Das zeichnet sich schon in der langsamen Einleitung des ersten Satzes (Adagio molto – Allegro con brio ab). Der laute Fortissimo-Auftakt wird in der Klaviertrio-Fassung von allen drei Instrumenten intoniert. Im Orchester-Original ist es – erwartungsgemäß – das ganze Orchester. Wenn aber der heftige Auftakt nach wenigen Takten wiederkehrt, so hören wir diesen in der Trio-Fassung nur von Geige und Cello, während das Klavier noch mit der (ursprünglichen) Holzbläser-Passage beschäftigt ist.
»Originell und interessant«
Der zweite Satz (Larghetto) könne in der Triofassung – laut Rezensent – zwar nicht »unmittelbar die Reize oder die besondere Behandlungsweise gewisser Instrumente« vermitteln; aber der dritte Satz (Scherzo. Allegro – Trio) bleibe auch in der Bearbeitung »originell« und »interessant«. Zum Finale (Allegro molto) notierte besagter Autor:
»Der letzte Satz, in seiner tumultuarischen, wilden Abenteuerlichkeit, konnte nicht so genügend eingerichtet werden; auch ist er, obgleich es auf den ersten Anblick nicht so scheint, sehr schwer zu spielen, so dass man ihn auch in dieser Form nur selten vollkommen ausgeführt hören wird.«
Umso spannender, die Bearbeitung heute einmal live vom Trio Orelon zu erleben!
Arno Lücker
Wir danken den Mitgliedern des Freundeskreises
MÄZEN
Gründungsmitglieder Arndt und Helmut Andreas Hartwig (Bonn)
PLATIN
Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)
Godesberg Gastronomie & Event GmbH
Olaf Wegner (Bad Honnef)
Wohnbau GmbH (Bonn)
GOLD
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)
Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)
Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)
Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)
SILBER
Bernd Böcking (Wachtberg)
Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)
Dr. Helga Hauck (Wachtberg)
Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)
Dr. Luciano und Ulrike Pizzulli (Bonn)
Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)
AUF EMPFEHLUNG unserer Mäzene Arndt und Helmut Andreas Hartwig
Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama
BRONZE
Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Heike Fischer und Carlo Fischer-Peitz (Königswinter) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Prof. Ingeborg Henzler und Dr. Mathias Jung (Bendorf-Sayn) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Matthiaß-Küster und Norbert Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)
Biografien
Trio Orelon
»Sinfonische Dichte, homogener Gesamtklang, kammermusikalische Intensität und Emotionalität« (FAZ) – diese Worte beschreiben die außergewöhnliche Qualität des Trio Orelon, das sich seit seiner Gründung 2018 in Köln als eines der spannendsten Kammermusik-Ensembles etabliert hat. In kürzester Zeit hat das Trio bedeutende Wettbewerbe gewonnen, darunter der erste Preis und Publikumspreis beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München. Der Name »Orelon«, entlehnt aus der Weltsprache Esperanto, bedeutet »Ohr« und steht sinnbildlich für die zentrale Bedeutung des Hörens in ihrer Musik. Das Trio, dessen Mitglieder sich an den Musikhochschulen in Köln und Berlin kennenlernten, verbindet tiefgehende musikalische Harmonie mit unbändiger Energie und einem ausgeprägten Gespür für Nuancen. Konzertreisen führten in renommierte Säle und Festivals wie das Concertgebouw Amsterdam, den Wiener Musikverein, den Pierre-Boulez-Saal Berlin und das Ravenna Festival in Italien. In seinen Programmen entführt das Trio sein Publikum in innovative thematische Konzertkonzepte. Mit »Beethovens Töchter« hat es ein wegweisendes Projekt ins Leben gerufen, das die Musik vergessener Komponistinnen in den Mittelpunkt rückt.
Nina Kazourian
Nina Kazourian, Bratschistin und Singer-Songwriterin aus Valence, Frankreich, studierte Anthropologie zwischen Lyon und Stockholm und anschließend Bratsche und Neue Musik in Strasbourg und Stuttgart. Sie konzertiert mit verschiedenen Ensembles der klassischen und Neuen Musik in Europa, Australien und China, etwa mit dem National Orchestra of Irak und dem ULYSSES Ensemble für Neue Musik. Sie ist Mitglied des Stegreif Orchesters, in dem sie als Violistin, Sängerin und Komponistin kreativ tätig ist. In der Stegreif Orchester-Produktion »#Bechange: Awakening!« (Ludwigsburger Schlossfestspiele 2022) war sie gemeinsam mit Tabea Schrenk Komponistin. Ihr Soloprojekt als Singer-Songwriterin wurde mit ihrem Debütalbum »Under Rivers« in November 2021 geboren. Zurzeit arbeitet sie an ihrem zweiten Solo-Album. Darüber hinaus komponierte und performte sie in Musiktheaterproduktionen am Musikverein Wien, der Philharmonie Luxemburg und der Neuköllner Oper Berlin.
Konzerttipps
Mehr Beethoven-Sinfonik
im BeethovenfestAwareness
Awareness
Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.
Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.
Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).
Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.
Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.
Programmheftredaktion:
Sarah Avischag Müller
Julia Grabe
Die Texte von Arno Lücker sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.