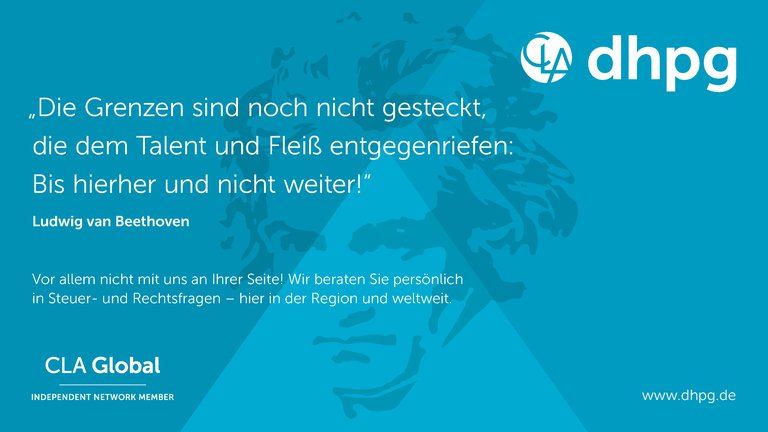»Es sind 32 Stücke, und es ähneln sich keine zwei davon. Jeder Moment ist neu und aufregend – das finde ich unglaublich.«
– Fabian Müller
Fr 5.9.2025
19.30 Uhr, Beethoven-Haus Bonn
Fabian Müller: Beethovensonaten II
- Klavier
- Vergangene Veranstaltung
- € 48

Mitwirkende
- Fabian Müller Klavier
Programm
Bagatellen
Klaviersonate Nr. 15 D-Dur op. 28 »Pastorale«
Klaviersonate Nr. 3 C-Dur op. 2/3
Klaviersonate Nr. 24 Fis-Dur op. 78
Klaviersonate Nr. 30 E-Dur op. 109
Auf einen Blick
Was erwartet mich?
Vier Beethoven-Klaviersonaten aus allen Lebensphasen des Komponisten, alle Facetten der Möglichkeiten am Klavier ausschöpfend.
Wie klingt das?
Beschreibung
Fabian Müller erklimmt den Mount Everest der Klavierliteratur: Alle Beethoven-Klaviersonaten in zwei Festivaljahrgängen. Er kombiniert Sonaten, die Beethoven mit zwanzig, dreißig und fünfzig Jahren schrieb, und zeigt so dessen Wandel vom selbstbewussten jungen Genie zum weltabgewandten, komplexen Denker. Jeder Sonate stellt Müller eine eigene Bagatelle als Kommentar voran. Den Auftakt bildet die bekannte »Pastorale«, die wegen ihrer musikalischen Naturmalerei diesen Beinamen trägt. Das Klavier imitiert etwa den Ruf der Wachtel. »Schöner könnte man sein Entzücken an der Natur nicht ausdrücken«, sagt der Pianist.
Das Video wurde im Pierre Boulez Saal für Fabian Müllers Beethoven-Klaviersonaten-Zyklus der Saison 2024/25 aufgenommen.
Magazin
Alle Beiträge
Digitales Programmheft
Fr 5.9.
19.30 Uhr, Beethoven-Haus Bonn
Fabian Müller: Beethovensonaten II
Mitwirkende
Fabian Müller Klavier
Programm
Fabian Müller (*1990)
Bagatellen (jeder Sonate vorangestellt)
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Klaviersonate Nr. 15 D-Dur op. 28 »Pastorale«
I. Allegro
II. Andante
III. Scherzo. Allegro vivace
IV. Rondo. Allegro, ma non troppo
Klaviersonate Nr. 3 C-Dur op. 2/3
I. Allegro con brio
II. Adagio
III. Scherzo. Allegro
IV. Allegro assai
Pause
Klaviersonate Nr. 24 Fis-Dur op. 78
I. Adagio cantabile – Allegro, ma non troppo
II. Allegro vivace
Klaviersonate Nr. 30 E-Dur op. 109
I. Vivace, ma non troppo – Adagio espressivo
II. Prestissimo
III. Gesangvoll, mit innigster Empfindung. Andante molto cantabile ed espressivo
Über den Konzertabend
Konzertdauer: ca. 125 Minuten
Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.
Für ein ungestörtes Konzerterlebnis bitten wir Sie, auf Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.
Der Freundeskreis Beethovenfest Bonn wünscht Ihnen bei den Konzerten seines Vorsitzenden Fabian Müller viel Freude!
Grußwort
Liebe Musikbegeisterte,
Wir freuen uns auf ein besonderes Konzert mit Fabian Müller. Er spielt Klaviersonaten von Beethoven und stellt ihnen jeweils eine selbst komponierte Bagatelle zur Seite. Durch sein Spiel, aber auch durch seine Eigenkompositionen holt er die Musik in ganz besonderer Weise über die zeitlichen Grenzen zu uns.
Entsprechend muss auch jedes Unternehmen sich auf ständig verändernde Rahmenbedingungen einstellen und seine Kultur, Produkte und Arbeitsweisen anpassen. Seit über 75 Jahren helfen wir, die dhpg, den Unternehmen dabei. Und wir sind stolz darauf, den Standort Bonn mit seiner sportlichen und kulturellen Vielfalt zu fördern. Deshalb unterstützen wir auch das Beethovenfest seit vielen Jahren.
Wir sind dankbar, mit Ihnen Teil dieses besonderen Abends mit Fabian Müller zu sein und wünschen uns und Ihnen ein unvergessliches Konzerterlebnis. Lassen Sie uns gemeinsam die Musik feiern und die wunderbaren Klänge genießen, die die Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herstellen.
Dr. Andreas Rohde
Senior Partner dhpg
Dieses Konzert wird gefördert durch
Einleitung
Dieses Programm in Fabian Müllers Festival-Zyklus reicht von der dritten bis zur drittletzten Klaviersonate, die Beethoven geschrieben hat. Die zwischen 1794 und 1820 entstandenen Werke umfassen zwei, drei oder vier Sätze und veranschaulichen die Entwicklung des Komponisten auf besonders verdichtete Weise.
In der naturnahen »Pastorale«, der 24. Sonate, und im ergreifenden Variationen-Satz des Opus 109 ist Beethoven als Komponist der Innigkeit und Ruhe zu erleben. Daneben treten aber auch starke Kontraste hervor: Die späte E-Dur-Sonate führt in die Nähe der letzten Dinge des Lebens. Die »frische Virtuosität« des frühen Werks in C-Dur wirkt auf Fabian Müller dagegen wie »sprudelndes Wasser« und ein beschwingter »Frühlingstag«.
Klaviersonate Nr. 15
Zahlen und Fakten: Ludwig van Beethoven, Klaviersonate Nr. 15 D-Dur op. 28 »Pastorale«
Komponiert: 1801
Gewidmet: Joseph Reichsfreiherr von Sonnenfels
Originaler Beiname: »Grande Sonata« – der Beiname »Pastorale« ist vom Verleger Cranz
Mannigfaltige Erscheinungsformen der Natur
Beethoven hat seine 15. Klaviersonate selbst nicht als »Pastorale« bezeichnet. Er legte aber offenbar auch keinen Widerspruch ein, als das Werk unter diesem Titel beim Hamburger Verlag Cranz veröffentlicht wurde. Auf die Sphäre der Natur scheint der in der Sonate auffällig oft eingesetzte ›Orgelpunkt‹ zu verweisen. Der Begriff meint einen Ton, der auf der Orgel liegenbleibt, auf dem Klavier aber wegen des kurzen Nachhalls immer wieder angeschlagen wird. Er bildet über längere Passagen den Ruhepunkt einer musikalischen Struktur und erhält zugleich bei jedem Wechsel der Tonart eine neue Funktion. So kann man sich vorstellen, dass Pflanzen oder Bäume im Wald, je nach Einfall des Sonnenlichts, ständig andere Erscheinungsformen annehmen. Ein solcher Orgelpunkt ist dem ersten Thema der Sonate, das sich in kleinen Tonschritten entfaltet, über mehr als 30 Takte unterlegt.
m ersten Satz, der nur gelegentlich die Zone der gedämpften Lautstärke verlässt, wirken die schnelleren Figuren, als seien sie von einer sanften Brise angestoßen. Wunderbar hat Beethoven das Zur-Ruhe-Kommen der Musik vor dem Wiederauftritt des ersten Themas auskomponiert. Auch im idyllischen Andante, dessen Melodie von tropfenhaften Tönen der linken Hand begleitet wird, und im eher rustikalen vierten Satz begegnen wir Orgelpunkten. Während die ersten drei Sätze leise verklingen, endet der letzte nach einem äußerst virtuosen Schlussabschnitt mit donnernden Akkorden im Fortissimo.

Beethovens Klaviersonaten
Beethoven hat bereits in seiner frühen Zeit in Bonn einige mehrsätzige Werke für Klavier solo geschrieben, die als »Kurfürstensonaten« bekannt geworden sind. Die 32 Sonaten, die er unter Opusnummern veröffentlichte, sind alle in Wien zwischen 1795 und 1822 entstanden. In seinen letzten fünf Lebensjahren hat der Komponist keine Sonaten mehr vollendet. 23 Werke stehen in einer Dur- und neun in einer Moll-Tonart. Sechs Sonaten bestehen aus zwei, 14 Sonaten aus drei und 12 Sonaten aus vier Sätzen. Bis zur 20. Sonate hat Beethoven manchmal mehrere Werke unter einer gemeinsamen Opusnummer veröffentlicht, danach erschienen seine Sonaten als Einzelwerke mit eigener Opuszahl.
Klaviersonate Nr. 3
Zahlen und Fakten: Ludwig van Beethoven, Klaviersonate Nr. 3 C-Dur op. 2/3
Komponiert: 1794/95
Gewidmet: Joseph Haydn, zu der Zeit Kompositionslehrer Beethovens
Virtuosität und langer Atem
Die ersten drei Klaviersonaten, die Beethoven unter einer Opusnummer veröffentlichte (op. 2), widmete er seinem kurzzeitigen Lehrer Joseph Haydn. Die Stücke verraten Anspruch und Ehrgeiz des noch jungen Komponisten. Alle umfassen vier Sätze, was damals keineswegs der Norm entsprach. Gerade die technisch besonders anspruchsvolle dritte Sonate in C-Dur lässt den meisterhaften Pianisten erahnen, der Beethoven war. In dieser Hinsicht wirkt das leise, wie hingehuschte erste Thema des Werks wie die Stille vor dem Sturm, der im Folgenden ausbricht.
Die Nähe zu Beethovens ersten beiden, teilweise gleichzeitig entstandenen Klavierkonzerten zeigt sich besonders in einer Passage des ersten Satzes, die nach der Art einer ›Kadenz‹ gestaltet ist. In ihr können Solist:innen ihre technischen Fähigkeiten demonstrieren, während das Orchester schweigt.
Das Adagio ist ein gutes Beispiel dafür, dass Beethoven schon in frühen Jahren mit langem Atem komponieren konnte. Das erste, fragende Thema ist von spannungsvollen Pausen durchsetzt, und im folgenden Abschnitt verwebt sich eine durchlaufende Figur der rechten Hand mit melodischen Linien und Seufzermotiven der linken.
Die Außenteile des humorvollen Scherzos deuten einen dreistimmigen Kanon an. Im Mittelteil des Satzes rauschen schnelle Skalen auf und ab und am Ende in die Tiefe. Das Finale schließlich stellt ein elegant federndes Thema choralartigen Passagen gegenüber. Eine ganz ähnliche Konstellation von Ausdruckcharakteren wird man später in der Musik von Felix Mendelssohn finden.

Klaviersonate Nr. 24
Zahlen und Fakten: Ludwig van Beethoven, Klaviersonate Nr. 24 Fis-Dur op. 78
Komponiert: Okt. 1809
Gewidmet: Gräfin Therese von Brunsvik, ehemalige KIavierschülerin und Freundin Beethovens
Lyrik und Heiterkeit
Nach der Vollendung der gewaltigen »Appassionata« dauerte es fünf Jahre, bis Beethoven 1809 wieder eine Klaviersonate schrieb. Vielleicht hat es mit dieser Rückkehr zu einer länger vernachlässigten Gattung zu tun, dass Beethoven das Werk in Fis-Dur besonders am Herzen lag. Oder auch mit der Erinnnerung an die Widmungsträgerin Therese von Brunsvick – in seine frühere Klavierschülerin war der Komponist einmal verliebt gewesen. (Thereses Schwester Josephine halten einige Forscher für Beethovens viel umrätselte »unsterbliche Geliebte«.)
Wie einige von Beethovens originellsten Sonaten besteht seine einzige in der seltenen Tonart Fis-Dur nur aus zwei Sätzen. Sie unterscheiden sich stark, ohne dass insgesamt ein dramatischer Kontrast dargestellt würde. Eher stehen sich in den beiden Sätzen stille Sanglichkeit und ausgelassene Heiterkeit gegenüber.
Obwohl das erste Thema der Sonate bei näherer Betrachtung kleinteilig und rhythmisch sehr flexibel gestaltet ist, scheint die Musik aus einer großen inneren Ruhe zu strömen. Der Beethoven-Biograf Jan Caeyers hat von einem »neuen Gefühl für das Lyrische« gesprochen, das der Komponist für die Werke dieser Zeit entdeckte.
Der zweite Satz stellt vielleicht ein Gespräch zwischen zwei Charakteren nach: Ein heftiges Statement wird zweimal mit einer verhaltenen Phrase beantwortet, bevor der erste Charakter beim dritten Anlauf selbst die Stimme senkt. Im Folgenden entwickelt sich eine wilde, immer wieder vom Eingangs-Statement unterbrochene Jagd über die Tasten. Vor der rasanten Schlusspassage gestattet Beethoven eine kurze Pause zum Luft holen.

Klaviersonate Nr. 30
Zahlenu und Fakten: Ludwig van Beethoven, Klaviersonate Nr. 30 E-Dur op. 109
Komponiert: 1820
Gewidmet: Maximiliane Brentano, damals 18-jährige Tochter von Beethovens Freundin Antonie Brentano
Letzte Worte
Die Klaviersonate Nr. 30 ist die drittletzte im Schaffen des Komponisten. Ihr ging die gewaltige »Hammerklaviersonate« voraus. Nach diesem Werk konnte auf demselben Gebiet eigentlich nichts mehr – oder doch nur etwas ganz Anderes – folgen. Und etwas ganz Anderes folgte mit den letzten drei Klaviersonaten. Sie sind miteinander verwandt – und zugleich vollständig individuell.
In der Sonate op. 109 dienen die relativ kurzen ersten beiden Sätze, die ohne Unterbrechung ineinander übergehen, zur Vorbereitung des letzten. Er nimmt alleine etwa zwei Drittel der Spieldauer in Anspruch. Der rasche, aber nicht hastige erste Satz ist geprägt von einem Pendelmotiv und kontrastierenden langsamen Einschüben. Im zweiten Satz treten sich entschlossene und reflektierende Gesten gegenüber. Auf die heftigen Moll-Akkorde, mit denen dieser Satz endet, scheint der Beginn des Finales beschwichtigend in Dur zu antworten. Sein unendlich rührendes Thema wirkt wie von einer leuchtenden inneren Klarheit beseelt.
Auflösung und Wiederkehr
Dieses Finale ist einer der großen Variationssätze Beethovens. In traditionellen Sätzen dieses Typs ist jede Variation durch ein spezifisches Gestaltungsmittel oder einen bestimmten emotionalen Ausdruck charakterisiert. Beethovens Variationen zeigen dagegen einen hohen Grad der internen Differenzierung. So wird das Thema in der zweiten zunächst in Einzeltöne zerlegt, dann in gesanglicher Gestalt und zum Ende hin in Akkordblöcken präsentiert. In der letzten Variation schließlich verkürzen sich die Notenwerte immer mehr. Beethoven scheint den Prozess der Verarbeitung des Themas bis zu dessen Auflösung zu treiben. Über Stellen wie diese hat der Musikwissenschaftler Siegfried Mauser geschrieben: »Reiner Klang scheint hier als letzte Ursubstanz von thematisch gebundener Musik.« Aber die Auflösung behält nicht das letzte Wort. In friedvoller Ruhe erklingt am Ende noch einmal das Eingangs-Thema, das seine Transformationen unbeschadet überstanden hat.
Benedikt von Bernstorff

Variationen
Der Begriff meint eine musikalische Gattung oder Satzform. Zu Beginn wird ein Thema vorgestellt, ein geschlossener musikalischer Abschnitt. Dieses Thema wird nun mehrmals in immer unterschiedlicher Gestalt wiederholt: Jeder dieser Abschnitte ist eine ›Variation‹ des Themas. Typischerweise kann man die Grundgestalt des Themas bei jeder Wiederholung noch erkennen – zum Beispiel bleiben die Länge und Struktur immer gleich, auch das Verhältnis der Akkorde zueinander.
Vor Beethovens Sonaten war dieser Satztyp in Klaviersonaten eher selten. Bei Beethoven werden die Variationen zu einem innovativen Versuchsfeld: Er nutzte die Form, um Musik prozesshaft umzuformen – und sie nicht als statische Struktur, sondern als dynamische Transformation zu verstehen.
Interview
Fabian Müller
im InterviewTrotz ihrer berühmten sinfonischen Namensschwester gehört die »Pastorale«-Sonate nicht zu den besonders bekannten Werken des Klaviersonaten-Zyklus. Finden Sie, dass der Beiname, der ja nicht von Beethoven stammt, zu dem Stück passt?
Fabian Müller: Ich denke schon. Ich habe die Assoziation eines Ankommens in einer Landschaft, die man in ihrer Tiefe, sozusagen in ihrer Dreidimensionalität erlebt. Es gibt längere Passagen, in denen nicht thematisch gearbeitet, sondern ein unveränderter Zustand ausgekostet wird.
Noch weniger bekannt ist die 24. Sonate, die in der ungewöhnlichen Tonart Fis-Dur steht.
Beethoven hat sie selbst sehr gemocht und behauptete sogar, sie sei »besser« als die »Mondschein-Sonate«. Für mich ist sie besonders nah an seiner Persönlichkeit. Wenn man das Stück spielt, spürt man, dass er ein liebevoller Mensch war. Es ist kein Funken Wut in der Sonate. Der zweite Satz hat etwas Ausgelassenes, Neckisches und auch etwas Zärtliches. Beethoven war nicht immer der kämpfende Titan, als der er so oft wahrgenommen wird.
Sie spielen vor jeder Sonate eine selbst komponierte Bagatelle als Prolog. Wie kam es zu dieser Idee? Und welche Art von Musik dürfen wir erwarten?
Es war mir wichtig, dem Zyklus etwas Eigenes von mir zu geben und so die Reise durch diese Werke noch persönlicher zu gestalten. Ich liebe die Idee des weißen Blatts und ich mag es, wenn das Publikum nicht genau weiß, was als Nächstes kommt. Die Form der Bagatelle [der Begriff kommt vom französischen Wort für ›Kleinigkeit‹] erlaubt es, mit der Doppeldeutigkeit zwischen scheinbarer Belanglosigkeit und tieferer Bedeutung zu spielen. Ich verstehe meine Bagatellen als eine Art von ›Präludien‹ oder ›Vorworten‹. Manchmal sind sie durch direkte Zitate nah an der betreffenden Sonate, manchmal bilden sie einen Kontrast oder reflektieren die Atmosphäre von Beethovens Werk.
Wir danken den Mitgliedern des Freundeskreises
MÄZEN
Gründungsmitglieder Arndt und Helmut Andreas Hartwig (Bonn)
PLATIN
Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)
Godesberg Gastronomie & Event GmbH
Olaf Wegner (Bad Honnef)
Wohnbau GmbH (Bonn)
GOLD
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)
Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)
Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)
Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)
SILBER
Bernd Böcking (Wachtberg)
Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)
Dr. Helga Hauck (Wachtberg)
Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)
Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)
AUF EMPFEHLUNG unserer Mäzene Arndt und Helmut Andreas Hartwig
Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama
BRONZE
Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Heike Fischer und Carlo Fischer-Peitz (Königswinter) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Prof. Ingeborg Henzler und Dr. Mathias Jung (Bendorf-Sayn) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Matthiaß-Küster und Norbert Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Silke und Andreas Tiggemann (Alfter) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)
Biografie
Fabian Müller
BiografieDer gebürtige Bonner Fabian Müller hat sich in den vergangenen Spielzeiten als einer der bemerkenswertesten Pianist:innen seiner Generation etabliert. Für großes Aufsehen sorgte er 2017 beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb in München, bei dem er gleich fünf Preise erhielt. Seither entwickelt sich seine Konzerttätigkeit auf hohem Niveau: 2018 gab er mit dem Bayerischen Staatsorchester sein Debüt in der New Yorker Carnegie Hall und trat erstmals in der Elbphilharmonie auf. In der vergangenen Saison führte er auf Einladung von Daniel Barenboim sämtliche Klaviersonaten Beethovens im Berliner Pierre Boulez Saal auf und begann den Zyklus ebenso beim Beethovenfest Bonn.
Fabian Müller musiziert regelmäßig mit bedeutenden Klangkörpern wie dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Seine rege Beschäftigung mit der Musik Johann Sebastian Bachs spiegelt sich unter anderem in einer längerfristig angelegten Zusammenarbeit mit den Berliner Barock-Solisten, einem Ensemble der Berliner Philharmoniker. Beim Rheingau Musik Festival führt er seit dem vergangenen Sommer, verteilt auf mehrere Jahre, sämtliche Klavierkonzerte Mozarts auf, die er vom Klavier aus leitet.
Auf der Suche nach seinem eigenen Klangideal gründete er außerdem sein eigenes Kammerorchester: The Trinity Sinfonia. Das Ensemble debütierte 2023 beim Rheingau Musik Festival; mit ihm führt er als Dirigent ab 2024 sämtliche Sinfonien Beethovens beim Bonner Beethovenfest auf.
Neben seiner Konzerttätigkeit engagiert sich Fabian Müller im Bereich der Musikvermittlung. Im Rahmen des Klavier-Festivals Ruhr arbeitet er jedes Jahr mit mehr als 300 Kindern zusammen, die sich auf schöpferische Weise mit moderner Musik auseinandersetzen. Dieses Projekt wurde 2014 mit dem Junge-Ohren-Preis und 2016 mit einem ECHO Klassik ausgezeichnet.
Fabian Müller verbindet eine exklusive Zusammenarbeit mit dem Label Berlin Classics. Seine erste CD erschien im Herbst 2018 und enthält Soloklavierwerke von Johannes Brahms. 2020 wurde dort eine weitere CD mit Werken von Beethoven, Schumann, Brahms und Rihm veröffentlicht. Im Frühjahr 2022 folgte sein drittes Album, das die drei letzten Sonaten Schuberts beinhaltet. Darüber hinaus erschien bei der Deutschen Grammophon ein Mozart-Album, das er zusammen mit Albrecht Mayer einspielte.
Dem Beethovenfest in seiner Heimatstadt ist Fabian Müller tief verbunden: Durch seine Beethovensonaten-Konzertreihen und als erster Vorsitzender des Freundeskreises Beethovenfest Bonn e. V.
Konzerttipps
Fabian Müller
Der Beethoven-Zyklus im Festival 2025Awareness
Awareness
Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.
Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.
Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).
Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.
Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.
Programmheftredaktion:
Sarah Avischag Müller
Julia Grabe
Lektorat:
Heidi Rogge
Die Texte von Benedikt von Bernstorff sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.