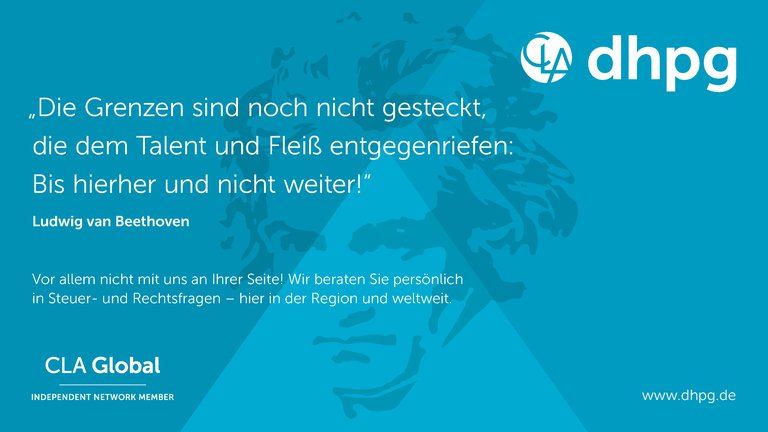Fabian Müller Klavier

Digitales Programmheft
So 31.8.
11 Uhr, Oper Bonn
Fabian Müller: Beethovensonaten I
Mitwirkende
Programm
Fabian Müller (*1990)
Bagatellen (jeder Sonate vorangestellt)
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Klaviersonate Nr. 14 cis-Moll op. 27/2 »Mondschein-Sonate«
I. Adagio sostenuto
II. Allegretto
III. Presto agitato
Klaviersonate Nr. 16 G-Dur op. 31/1
I. Allegro vivace
II. Adagio grazioso
III. Rondo. Allegretto
Pause
Klaviersonate Nr. 6 F-Dur op. 10/2
I. Allegro
II. Allegretto
III. Presto
Klaviersonate Nr. 31 As-Dur op. 110
I. Moderato cantabile molto espressivo
II. Allegro molto
III. Adagio, ma non troppo – Fuga. Allegro, ma non troppo
Über den Konzertabend
Konzertdauer: ca. 115 Minuten
Gastronomisches Angebot vor Ort
Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.
Für ein ungestörtes Konzerterlebnis bitten wir Sie, auf Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.
Der Freundeskreis Beethovenfest Bonn wünscht Ihnen bei den Konzerten seines Vorsitzenden Fabian Müller viel Freude!
Meet the Ultras im Wandelgarten
Wir laden ein zu Gespräch und Pausensnack mit den Beethovenfest-Ultras im Wandelgarten auf der obersten Außenterrasse der Oper. Kommen Sie in der Pause vorbei zum Austausch über vielfältige Leidenschaften, Hingabe und Ekstase. Der Wandelgarten ist auch vor und nach dem Konzert geöffnet.
Dieses Konzert wird gefördert durch die Sparkasse KölnBonn
Einleitung
Fabian Müller
Beethovensonaten IIn diesem Jahr ist beim Beethovenfest der zweite Teil von Fabian Müllers zyklischer Aufführung aller 32 Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven zu erleben. Die Anordnung der Werke folgt dabei nicht der Chronologie ihrer Entstehung, sondern soll mit jedem Programm den Komponisten in seiner Entwicklung, seinem Sinn für Kontraste und dem unerschöpflichen Reichtum seiner Fantasie portraitieren. Zusätzlich stellt der Bonner Pianist jeder Sonate eine eigene Bagatelle als Kommentar voran.
Im ersten Konzert erklingen die 16. und die sechste Sonate als Beispiele für den Witz des überaus geistreichen Wiener Klassikers. Die Nr. 14, die unter dem Beinamen »Mondschein-Sonate« berühmt geworden ist, gilt dagegen als Inbegriff des »romantischen« Beethoven. Und wie alle vier Programme in diesem Festivaljahrgang beschließt Fabian Müller auch das erste mit einer Sonate aus dem Spätwerk des Komponisten: Das als Opus 110 veröffentlichte Werk endet mit einem Satz, der zunächst in die Welt der Oper führt und anschließend auf die Epoche der Barockmusik verweist.
Interview

Fabian Müller
im InterviewSie haben inzwischen den vollständigen Zyklus von Beethovens Klaviersonaten in Berlin im durchgängig ausverkauften Pierre Boulez Saal gespielt. 2025 bringen Sie nun die auf zwei Jahre verteilte Gesamtaufführung in Ihrer Heimatstadt Bonn zum Abschluss. Hat sich Ihr Blick auf die Werke durch die Auftritte in Berlin noch einmal geändert?
Fabian Müller: Ich erlebe die zyklischen Aufführungen als unglaublich intensiv und mache in jedem Konzert unerwartete Erfahrungen. Ich denke schon, dass ich mich mit den Sonaten in einem Reifeprozess befinde und sie heute ein wenig erwachsener spiele als früher.
Die G-Dur-Sonate op. 31/1, die Sie in Ihrem diesjährigen Auftaktkonzert spielen, könnte man wegen ihrer Komik dagegen ja fast ein wenig »unerwachsen« finden. Halten Sie das Stück auch für so lustig?
Sie ist für mich die exotischste der Sonaten. Bei ihr ist es eine seltsame Form von Lustigkeit, über die man einerseits lacht, die einen andererseits aber auch zum Nachdenken bringt. Übrigens ist dieses Stück besonders unangenehm zu spielen.
Der Kontrast zur »Mondschein-Sonate« und zur Sonate op. 110, der vorletzten von Beethoven, könnte ja nicht größer sein.
Ich bin ein großer Fan von Programmen, in denen möglichst unterschiedliche Werke aufeinandertreffen. In der »Mondschein-Sonate« wird ein eher unauffälliger zweiter Satz von der göttlichen Poesie des ersten Satzes und dem schicksalhaften Furor des Finales eingerahmt. Und Opus 110 ist ein Anwärter für das letzte Stück, das man in seinem Leben spielen möchte.
Sie spielen vor jeder Sonate eine selbst komponierte Bagatelle als Prolog. Wie kam es zu dieser Idee? Und welche Art von Musik dürfen wir erwarten?
Es war mir wichtig, dem Zyklus etwas Eigenes von mir zu geben und so die Reise durch diese Werke noch persönlicher zu gestalten. Ich liebe die Idee des weißen Blatts und ich mag es, wenn das Publikum nicht genau weiß, was als Nächstes kommt. Und es gefällt mir natürlich, dass ich die Stücke in meiner Heimatstadt Bonn zur Uraufführung bringen kann. Die Form der Bagatelle [der Begriff kommt vom französischen Wort für ›Kleinigkeit‹] erlaubt es, mit der Doppeldeutigkeit zwischen scheinbarer Belanglosigkeit und tieferer Bedeutung zu spielen. Ich verstehe meine Bagatellen als eine Art von ›Präludien‹ oder ›Vorworten‹. Manchmal sind sie durch direkte Zitate nahe an der betreffenden Sonate, manchmal bilden sie einen Kontrast oder reflektieren die Atmosphäre von Beethovens Werk.
Klaviersonate Nr. 14
Zahlen und Fakten: Beethoven, Klaviersonate Nr. 14 cis-Moll op. 27/2 »Mondschein-Sonate«
Komponiert: 1801
Gewidmet: Gräfin Julie Guicciardi, einer Klavierschülerin von Beethoven
Originaler Beiname: Sonata quasi una Fantasia per il Clavicembalo o Piano-Forte
Fantasien über die »Mondschein-Sonate«
»Sonata quasi una Fantasia« nannte Beethoven beide Werke seines 1802 veröffentlichten Opus 27, dessen zweites man unter dem nicht vom Komponisten stammenden Namen »Mondschein-Sonate« kennt. Der ungewöhnliche Begriff deutet an, dass die Musik fast im Sinne einer Improvisation der Einbildungskraft folgt.
Die atmosphärische Dichte und die ungewöhnliche formale Gestalt hat die Nachwelt dazu veranlasst, selbst ausgiebig über die Bedeutung der Sonate zu ›fantasieren‹: War die Widmungsträgerin, Beethovens Klavierschülerin Julie Guicciardi, jene geheimnisvolle »unsterbliche Geliebte«, an die er Jahre später leidenschaftliche Liebesbriefe schreiben sollte? (Wie die Forschung gezeigt hat: Ganz sicher nicht.) Symbolisieren die verschwimmenden Klänge des leisen ersten Satzes mit dem Dämpferpedal die fortschreitende Ertaubung des Komponisten? (Man wird es nie erfahren.) Hören wir hier eine nächtliche Szene, wie der Beiname behauptet? (Niemand kann beweisen, dass es nicht so ist.)
»Blume zwischen Abgründen«
Das Thema des ersten Satzes gehört zu den bekanntesten der gesamten klassischen Musik. Es beginnt mit einem sechs Mal wiederholten Ton über einer rhythmisch gleichbleibenden, durchlaufenden Begleitfigur der linken Hand. Durch die Bewegung in andere Tonarten wird das Thema immer wieder neu beleuchtet. Der Satz gilt als Vorbild für das romantische Charakterstück, das im frühen 19. Jahrhundert sehr beliebt war. In ihm wird auf interne Kontraste weitgehend verzichtet, da ein bestimmter Gefühlszustand dargestellt werden soll.
Der kurze zweite Satz, der auf Franz Liszt wie eine »Blume zwischen zwei Abgründen« wirkte, inszeniert zwischen Phrasen aus gebundenen und kurzen Tönen ein Frage-Antwort-Spiel. Im Finale schießen Tonfolgen aus der Tiefe nach oben und münden in harte Akkordschläge: Ein Satz, der bis zum mächtigen Schluss von innerem Aufruhr und größter Virtuosität geprägt ist.
Das Thema
Unter dem Begriff versteht man in der Musik eine melodisch und rhythmisch bestimmte, abgrenzbare Gestalt, die verschiedene Motive und manchmal gegensätzliche Ausdrucks-Charaktere umfassen kann. Meistens werden im ersten Teil des Satzes (der ›Exposition‹) zwei Themen vorgestellt. Sie sind das Material, das im Prozess des Satzverlaufs verarbeitet wird. Beethoven ist unbestritten einer der größten Meister in dieser Kunst. Themen können zerlegt, in neue Tonarten versetzt oder miteinander in einen Konflikt gebracht werden.
Klaviersonate Nr. 16
Zahlen und Fakten: Beethoven, Klaviersonate Nr. 16 G-Dur op. 31/1
Komponiert: 1802
Erstveröffentlichung: 1803
Gut zu wissen: Vor der Veröffentlichung der drei Sonaten op. 31 verkündete Beethoven: »Ich bin mit meinen bisherigen Arbeiten nicht zufrieden. Von nun an will ich einen anderen Weg beschreiten.«
H wie Humor
Beethovens Sonaten-Zyklus ist eine Enzyklopädie aller nur denkbaren Ausdrucks-Charaktere, die auch unter dem Buchstaben H wie Humor mehrere Einträge aufweist. Es scheint, als wolle der Komponist in der Sonate Nr. 16 die »klappernden« Einsätze eines ungenau zusammenspielenden Ensembles parodieren: Im ersten Satz kommt nämlich die linke Hand im Verhältnis zur rechten immer wieder um einen winzigen Moment (technisch gesprochen: eine Sechzehntelnote) zu spät. Das zweite Thema springt zwischen Dur und Moll sowie rechter und linker Hand hin und her. Tänzerisch und heiter wirkt es durch seine zuverlässig gegen die Taktschwerpunkte gesetzten Betonungen.
Neuartiges für die Clavecinisten
Der ungewöhnlich ausgedehnte langsame zweite Satz klingt für Fabian Müller wie eine »Parodie des italienischen Gesangs«, als ob sich Beethoven »über Rossinis Opernstil lustig machen« wolle. Das eigentlich anmutige Thema des Finales trifft auf überraschende Akzente, rhythmische Gegenbewegungen zwischen beiden Händen und einen unerwarteten, radikal entschleunigten Einschub. Nach einigen sehr lauten Akkorden endet das Werk leise und beiläufig, als sei gar nicht viel geschehen.
Beethoven schrieb die drei Sonaten seines Opus 31 (außer der hier besprochenen noch die »Jagd«- und die »Sturm«-Sonate) für den Schweizer Verleger Hans Georg Nägeli. Dieser hatte sich vom Komponisten einen Beitrag zu seiner Sammlung »Repertoire des Clavecinistes« gewünscht, die möglichst neuartige Klaviermusik enthalten sollte. Neuartig ist die G-Dur-Sonate gerade wegen ihres erfindungsreichen Humors zweifellos.

Klaviersonate Nr. 6
Zahlen und Fakten: Beethoven, Klaviersonate Nr. 6 F-Dur op. 10/2
Komponiert: 1796–98
Gewidmet: Gräfin Anna Margarete von Browne
Dauer: Nur ca. 11 Minuten
Kontrastierende Ableitung
An den drei Sonaten von Beethovens Opus 10 lässt sich der musikwissenschaftliche Begriff der ›kontrastierenden Ableitung‹ besonders sinnfällig demonstrieren. Er bezeichnet das Verfahren, mit dessen Hilfe aus ein- und demselben thematischen Material ganz entgegengesetzte Wirkungen entwickelt werden. Die F-Dur-Klaviersonate beginnt mit Akkorden, welche die Tonart mit kurzen nachschlagenden Echofiguren bestätigen. Im doppelt so langen zweiten Teil des Themas entfaltet sich dann eine weit ausgreifende Melodielinie. Die nächste Passage setzt zur Wiederholung des Anfangs an, bevor eine überraschende Wendung dazwischenfährt und die zuvor sanfte Nachschlag-Figur plötzlich Heftigkeit signalisiert. Als abgeleiteten Kontrast kann man auch das zunächst als Kanon vorgestellte Thema des Finales deuten. Es greift nämlich auf die geheimnisvolle Tonfolge des Mittelsatzes zurück, wendet sie von Moll nach Dur und gewinnt ihr einen volkstümlich-humoristischen Charakter ab.

Klaviersonate Nr. 31
Zahlen und Fakten: Beethoven, Klaviersonate Nr. 31 As-Dur op. 110
Komponiert: 1821
Erstdruck: 1822
Krankheit und Genesung
Im Jahr 1821 erkrankte Beethoven schwer an Gelbsucht. Deshalb verzögerte sich die Vollendung von drei Werken, die er seinem Verleger bereits angekündigt hatte (die Klaviersonaten op. 109, 110 und 111). Mit dieser Trias schloss der Komponist sein Klaviersonaten-Schaffen ab.
Ergreifend zart und vorsichtig wirkt der fast durchgehend leise erste Satz von Beethovens vorletzter Sonate in As-Dur. Die Musik klingt hier so, als nehme sie Rücksicht auf die Empfindlichkeit eines Kranken und wolle diesem zugleich Mut zusprechen. Die eindringlich-sanfte erste Phrase kehrt am Schluss des Satzes in der linken Hand zurück. Im kurzen Mittelsatz treffen fragende Passagen, rhythmische Irritationen und Momente des Tempo-Stillstands auf bekräftigende, entschlossene Gesten.
Im Finale taucht nach einigen Einleitungstakten ein (instrumentales) Rezitativ auf, das normalerweise in der Oper oder im Oratorium die Atmosphäre für eine Arie vorbereitet. Im Anschluss entfaltet sich ein wunderbar frei gestalteter und schmerzvoller Gesang (»Arioso dolente«). An seinem Ende erklingen vier Töne im Bass, denen die Jesus-Worte »Es ist vollbracht« zugeordnet sind. In diesem Moment der Todesnähe erscheint die barocke Kompositionstechnik der Fuge, wie Fabian Müller im Gespräch interpretiert, als »Rettung«.
Die romantische Subjektivität nimmt gewissermaßen die Objektivität der strengen historischen Regeln zu Hilfe. Noch einmal aber hebt der Klagegesang an, nun immer wieder, wie aus Erschöpfung fast verstummend. Als Gegenstück zur ersten erscheint eine zweite Fuge, deren Thema (passagenweise gleichzeitig) in verkürzter, beschleunigter oder verlangsamter Form über orgelartigen Basstönen erklingt. Am Ende wird als Zeichen der Gesundung die Ziel-Tonart As-Dur erreicht, deren Töne wie aus reiner Quelle aus der Tiefe in die Höhe sprudeln.
Beethovens Klaviersonaten
Beethoven hat bereits in seiner frühen Zeit in Bonn einige mehrsätzige Werke für Klavier solo geschrieben, die als »Kurfürstensonaten« bekannt geworden sind. Die 32 Sonaten, die er unter Opusnummern veröffentlichte, sind alle in Wien zwischen 1795 und 1822 entstanden. In seinen letzten fünf Lebensjahren hat der Komponist keine Sonaten mehr vollendet. 23 Werke stehen in einer Dur- und neun in einer Moll-Tonart. Sechs Sonaten bestehen aus zwei, 14 Sonaten aus drei und 12 Sonaten aus vier Sätzen. Bis zur 20. Sonate hat Beethoven manchmal mehrere Werke unter einer gemeinsamen Opusnummer veröffentlicht, danach erschienen seine Sonaten als Einzelwerke mit eigener Opuszahl.
Benedikt von Bernstorff
Wir danken den Mitgliedern des Freundeskreises
MÄZEN
Gründungsmitglieder Arndt und Helmut Andreas Hartwig (Bonn)
PLATIN
Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)
Godesberg Gastronomie & Event GmbH
Olaf Wegner (Bad Honnef)
Wohnbau GmbH (Bonn)
GOLD
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)
Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)
Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)
Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)
SILBER
Bernd Böcking (Wachtberg)
Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)
Dr. Helga Hauck (Wachtberg)
Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)
Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)
AUF EMPFEHLUNG unserer Mäzene Arndt und Helmut Andreas Hartwig
Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama
BRONZE
Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Küster und Norbert Matthiaß-Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Silke und Andreas Tiggemann (Alfter) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)
Biografie
Fabian Müller

Der gebürtige Bonner Fabian Müller hat sich in den vergangenen Spielzeiten als einer der bemerkenswertesten Pianist:innen seiner Generation etabliert. Für großes Aufsehen sorgte er 2017 beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb in München, bei dem er gleich fünf Preise erhielt. Seither entwickelt sich seine Konzerttätigkeit auf hohem Niveau: 2018 gab er mit dem Bayerischen Staatsorchester sein Debüt in der New Yorker Carnegie Hall und trat erstmals in der Elbphilharmonie auf. In der vergangenen Saison führte er auf Einladung von Daniel Barenboim sämtliche Klaviersonaten Beethovens im Berliner Pierre Boulez Saal auf und begann den Zyklus ebenso beim Beethovenfest Bonn.
Fabian Müller musiziert regelmäßig mit bedeutenden Klangkörpern wie dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Seine rege Beschäftigung mit der Musik Johann Sebastian Bachs spiegelt sich unter anderem in einer längerfristig angelegten Zusammenarbeit mit den Berliner Barock-Solisten, einem Ensemble der Berliner Philharmoniker. Beim Rheingau Musik Festival führt er seit dem vergangenen Sommer, verteilt auf mehrere Jahre, sämtliche Klavierkonzerte Mozarts auf, die er vom Klavier aus leitet.
Auf der Suche nach seinem eigenen Klangideal gründete er außerdem sein eigenes Kammerorchester: The Trinity Sinfonia. Das Ensemble debütierte 2023 beim Rheingau Musik Festival; mit ihm führt er als Dirigent ab 2024 sämtliche Sinfonien Beethovens beim Bonner Beethovenfest auf.
Neben seiner Konzerttätigkeit engagiert sich Fabian Müller im Bereich der Musikvermittlung. Im Rahmen des Klavier-Festivals Ruhr arbeitet er jedes Jahr mit mehr als 300 Kindern zusammen, die sich auf schöpferische Weise mit moderner Musik auseinandersetzen. Dieses Projekt wurde 2014 mit dem Junge-Ohren-Preis und 2016 mit einem ECHO Klassik ausgezeichnet.
Fabian Müller verbindet eine exklusive Zusammenarbeit mit dem Label Berlin Classics. Seine erste CD erschien im Herbst 2018 und enthält Soloklavierwerke von Johannes Brahms. 2020 wurde dort eine weitere CD mit Werken von Beethoven, Schumann, Brahms und Rihm veröffentlicht. Im Frühjahr 2022 folgte sein drittes Album, das die drei letzten Sonaten Schuberts beinhaltet. Darüber hinaus erschien bei der Deutschen Grammophon ein Mozart-Album, das er zusammen mit Albrecht Mayer einspielte.
Dem Beethovenfest in seiner Heimatstadt ist Fabian Müller tief verbunden: Durch seine Beethovensonaten-Konzertreihen und als erster Vorsitzender des Freundeskreises Beethovenfest Bonn e. V.
Konzerttipps
Fabian Müller
Der Beethoven-Zyklus im Festival 2025Awareness
Awareness
Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.
Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.
Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).
Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.
Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.
Programmheftredaktion:
Sarah Avischag Müller
Julia Grabe
Lektorat:
Heidi Rogge
Die Texte von Benedikt von Bernstorff sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.