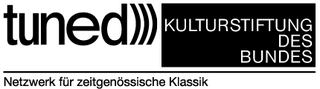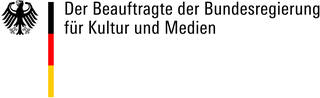Die extreme Arbeitsteilung zwischen Musiker:innen und Ensembles, ihren Agenturen und Veranstalter:innen im Geschäft der klassischen Musik hat viele gute Gründe. Wie in jedem ausdifferenzierten Wirtschaftsfeld eines kapitalistischen Umfelds werden Abläufe effizienter und der Output der Marktteilnehmer:innen maximiert, wenn sich Spezialist:innen um bestimmte Aufgaben kümmern. Nicht zuletzt geht es ja darum, dass die Künstler:innen möglichst hundert Prozent ihrer Energie auf die Lieferung des »Produkts« – das Konzert – verwenden können.
Wirtschaft, Kapitalismus, Geschäft, Output, Marktteilnehmer:innen, Produkt – das sind allesamt Begriffe, die wir ungern mit dem Wahren, Schönen und Guten der klassischen Musik in Zusammenhang bringen wollen. Doch vieles am klassischen Touring-Geschäft funktioniert unweigerlich nach diesen Mechanismen. Konzerte werden wie Produkte auf einem Markt angeboten, verschiedenste for-profit Unternehmen leben von diesem Markt, an dem eben auch gemeinnützige Organisationen und Konzertveranstalter:innen nicht nur partizipieren, sondern in dem sie oft vollständig verstrickt sind.
Es spricht nichts fundamental gegen diese Logik. Im Gegenteil bietet dieser arbeitsteilige Markt geniale Mechanismen, um Angebot und Nachfrage in Einklang zu halten, Talente und Wissen zielgerichtet einzusetzen, Ineffizienzen auszumerzen und Produktivität zu fördern. Es soll mit dieser Zuspitzung auch nicht suggeriert werden, dass es keine Beziehungen zwischen Künstler:innen und Veranstalter:innen gibt. Es stellt sich aber schon die Frage, ob wichtige Punkte der gemeinsamen Gestaltung des gesamten Ökosystems bei dieser hocheffizienten Arbeitsweise unter den Tisch fallen. Wir laufen so Gefahr, wichtige Entwicklungen, die in den unterschiedlichen Produktionslogiken anderer Kunstformen (z. B. Theater, bildende Kunst) längst den Diskurs prägen, zu verpassen. Wie in kapitalistischen Unternehmen braucht es auch in der Kultur »Forschungs- und Entwicklungsabteilungen«, in denen jenseits der aktuellen Marktzwänge über Zukunft und alternative Arbeitslogiken nachgedacht wird.
Das Projekt »Inside Artists« gründete sich also mit der Frage, welche alternativen Formen der direkten und eingebetteten Zusammenarbeit es mit Künstler:innen verschiedener Sparten geben kann. Es war eine Reaktion auf einen gewissen Frust, der sich aus den beschriebenen Dynamiken und einer damit einhergehenden Entfremdung zwischen uns als Veranstalter und Künstler:innen ergab. Wir wollten als Beethovenfest vor allem ein Forum der freien Zusammenarbeit entlang großer, gemeinsamer Fragestellungen an das geteilte Ökosystem der klassischen Musik finden. Es ging dabei nicht zuvorderst um künstlerischen Output, sondern um die Bedingungen und Epiphänomene unserer gemeinsamen Arbeit. Nicht zuletzt ging es auch darum, von- und miteinander zu lernen, also Künstler:innenförderung mit Organisationsentwicklung zu verbinden.
Dass solche prozessorientierte Vorhaben so selten möglich sind, hat auch mit den Förderbedingungen in Deutschland zu tun. Diese sind – wieder aus guten Gründen – sehr auf im Vorhinein klar beschreibbare Projekte ausgelegt, nicht auf ergebnisoffene Prozesse. Es ist ein großes Glück, dass wir mit der Kulturstiftung des Bundes im Rahmen von »tuned – Netzwerk für zeitgenössische Klassik« und der Liz Mohn Stiftung so vertrauensvolle wie neugierige Förderpartner hatten, die sich auf das durchaus gewagte Experiment einließen.
Zeitsprung zum Ende der Pilotphase – was haben wir gelernt? Wie messen wir den Erfolg oder Misserfolg von »Inside Artists«?
Fünf zentrale Erkenntnisse:
- Die recht abstrakten Fragestellungen des Projekts haben großes, allgemeines Interesse hervorgerufen – abzulesen an den 55 Bewerbungen, die wir auf unsere offene Ausschreibung hin erhalten haben. Dies zeigt, dass die Problembeschreibungen und Prämissen des Projekts vielfach geteilt werden, es folgerichtig einen unbefriedigten »Markt« für diese Idee gibt.
- Das Projekt ermöglichte neue Perspektiven auf die eigene Arbeit. Das ist als Selbstzweck schon ein großer Erfolg – nicht nur als Teambuilding-Maßnahme, sondern auch zur Übung des kreativen Miteinanders. Die Tatsache, dass regelmäßig Zeitfenster geschaffen wurden, um gemeinsam mit Künstler:innen über ein dezidiertes, oft übergeordnetes Arbeitsfeld zu sprechen, hatte einen hohen sinnstiftenden Wert, der auch von den Teilnehmenden sehr geschätzt wurde.
- Ein solches Projekt ist zunächst eine Zumutung. Alle haben übervolle Schreibtische, niemand hat Kapazitäten für Grundsätzliches – dies ist wiederum eine Nebenwirkung der Verwertungslogik unserer Zeit. Diese Resistenz zu überwinden war zunächst vor allem eine Führungsaufgabe. Wichtig war dabei auch, dass die Teams sich ihre Künstler:innen und die Projekte gemeinsam (mit) ausgesucht haben. Das Projekt muss einerseits von der Führung prioritär gesetzt werden und die Team-Motivation muss andererseits intrinsisch wachsen, damit eine solche Arbeitshaltung bei begrenzten zeitlichen Ressourcen als Prozess eine Chance hat.
- Obwohl das Projekt nicht outputorientiert angelegt war, entstanden daraus sehr fruchtbare inhaltliche und operative Perspektiven für das Beethovenfest. Die grundsätzliche Auseinandersetzung mit Gastgeberschaft und die Gestaltung von »Sternenmomenten« in Konzert-Kontexten brachte diverse »Aha-Erlebnisse« zutage, die unsere Art des Veranstaltens in der Zukunft prägen könnten. Das Arbeiten am Themenfeld sexualisierter Gewalt im Kulturbetrieb brachte ein bereichsübergreifendes Awareness-Team hervor, das das organisationale Bewusstsein des Beethovenfests schon jetzt positiv prägt.
- Ein solches Vorhaben braucht nicht nur Zeit, sondern auch regelmäßige Möglichkeiten der Reflexion. Die moderierte Prozessbegleitung durch Prof. Dr. Martin Zierold war in diesem Sinne sehr wesentlich. Wenn Künstler:innen intensiv auf das Innere von Organisationen treffen, dann prallen unterschiedliche Logiken aus disparaten Winkeln unseres kulturellen Ökosystems aufeinander. Da kommt es schnell zu Missverständnissen und Konflikten. Dass unsere Projekte alles in allem recht harmonisch verliefen, hat vor allem mit ausgedehnten Workshops und Reflexionsphasen zu tun. Diese halfen sehr, Blockaden zu lösen und Learnings zu konsolidieren.
»Inside Artists« war ein Pilotprojekt, das eine Infusion neuer Perspektiven und Ideen für alle Mitwirkenden und nicht zuletzt für das »Versuchsobjekt« Beethovenfest einbrachte. Es hatte eine positiv-disruptive Wirkung und war – wie die meisten Prozesse der Veränderung – mitunter anstrengend und schmerzhaft. Es ist sicher eine Überforderung, dauerhaft so intensiv und umfassend Künstler:innen in die Teams einer Organisation einzubinden. Aber es gibt nun ein »Proof of Concept«, dass »Inside Artists« als Projekt und Methode sehr gut funktioniert und für alle Beteiligten sowie für die Zukunftsfähigkeit von Kulturorganisationen große Mehrwerte bereithält. Die Nachahmung ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht! Dazu dient dieser Reader. Es geht schließlich auch darum, dass die eingangs beschriebene, systemische Arbeitstrennung von Künstler:innen und Institutionen zumindest kurzzeitig und phasenweise überwunden werden kann, damit wir gemeinsam, als kulturell-künstlerisches Ökosystem, über die Inhalte und Zukünfte unseres Schaffens nachdenken und diese gestalten können.