Scottish Chamber Orchestra
Colin Currie Schlagwerk
Maxim Emelyanychev Dirigent
3.9.– 3.10. 2026

Scottish Chamber Orchestra
Colin Currie Schlagwerk
Maxim Emelyanychev Dirigent
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Auszüge aus der Ballettmusik »Die Geschöpfe des Prometheus« op. 43
Overtura Adagio – Allegro molto e con brio
Introduzione La Tempesta. Allegro non troppo
Nr. 9 Adagio – Allegro molto
Nr. 10 Pastorale. Allegro
Nr. 16 Finale. Allegretto – Allegro molto – Presto
Sir James MacMillan (*1959)
»Veni, Veni, Emmanuel«. Schlagwerkkonzert
I. Introit – Advent
II. Heartbeats
III. Dance – Hocket
IV. Transition. Sequence
V. Gaude, Gaude
VI. Transition. Sequence II
VII. Dance – Chorale
VIII. Coda – Easter
Pause
Ludwig van Beethoven
Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67
I. Allegro con brio
II. Andante con moto
III. Scherzo. Allegro – Trio
IV. Allegro
Konzertdauer: ca. 130 Minuten
Gastronomisches Angebot vor Ort
Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.
Wir bitten Sie, auf eigene Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.
Dieses verschwiegene Refugium auf der obersten Rheinterrasse der Oper Bonn lädt Musikliebhabende vor, zwischen und nach den Konzerten zum lauschigen Stelldichein und zu schicksalhaften Begegnungen ein.
18.45 Uhr, Oper Bonn, Foyer
Konzerteinführung mit Hannah Schmidt und Gespräch mit Colin Currie
»Allein Freiheit, weiter gehn ist in der Kunstwelt, wie in der ganzen großen Schöpfung, Zweck.« Freiheit zu proklamieren, ist ein unerhörter Akt zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Für Beethoven eine Lebensmaxime. Einen ideellen Verbündeten findet er in Prometheus, den Goethe gegen die Götter aufbegehren lässt: »Hier sitz’ ich, forme Menschen nach meinem Bilde.« Und in seiner fünften Sinfonie stürmt Beethoven aus tiefer Bedrängnis in Licht, Freiheit und das pralle Leben. ›Ultra‹? Und ob! Auch Maxim Emelyanychev ist davon überzeugt und formuliert seine Sicht auf Beethoven: »Wir müssen dem Publikum zeigen, wie extrem es damals war, seine Musik zu hören.«
Die Verheißung von Freiheit in der christlichen Advents- und Osterbotschaft inspirierte hingegen Sir James MacMillan zur Komposition seines Schlagwerkkonzerts »Veni, Veni Emmanuel«. Herzschläge durchpulsen das Werk, das am Ende »geradewegs hinein ins Gloria der Osternachtsfeier« steuert, »als finde die Proklamation der Freiheit ihre Verkörperung im auferstandenen Christus« (MacMillan).

Ballettmusik »Die Geschöpfe des Prometheus« op. 43
Entstehung: 1800 bis Anfang 1801
Uraufführung: 28. März 1801 am Wiener Hofburgtheater
Besetzung: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, Bassetthorn (Nr. 14), 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, Pauken, Harfe (Nr. 5), Streicher
Die originale Ballettmusik enthält 16 Nummern plus zweiteilige Ouvertüre. Im heutigen Konzert erklingt diese zusammen mit drei ausgewählten Nummern.
Es sind harsche Worte, die Johann Wolfgang von Goethe seinen Prometheus dem Göttervater Zeus entgegenschleudern lässt:
»Hier sitz’ ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sey,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genießen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!«
Ein Vernunftwesen meldet sich da zu Wort, das sich über die Befehle der Götter hinwegsetzt: Prometheus entwendet das streng gehütete, heilige Feuer des Olymp und bringt es den Menschen. Er geht sogar noch weiter und formt Menschen nach seinem eigenen, einem widerspenstigen, sich selbst bewussten und aufgeklärten Geist. Das konnte um 1800 im Römisch-Deutschen Reich nicht jedem gefallen.
Aber einem gefiel es außerordentlich: Ludwig van Beethoven – dem Komponisten und Humanisten, dem die Idee einer selbstbestimmten republikanischen Gesellschaft ein großes Anliegen war. Kein Wunder also, dass der Wiener Ballettmeister Salvatore Viganò Beethovens Interesse weckte, als er ihn, vermutlich 1799, mit dem Gedanken konfrontierte, ein Ballett über Prometheus zu schreiben.

Der mythologische Titan sollte darin ein »erhabener Geist« sein, der »die Menschen zu seiner Zeit in einem Zustande von Unwissenheit antraf, sie durch Wissenschaften und Kunst verfeinerte und ihnen Sitten beybrachte«, wie es der Theaterzettel der Uraufführung ankündigt. Dort heißt es weiter:
»Von diesem Grundsatze ausgegangen, stellen sich in gegenwärtigem Ballet zwei belebt werdende Statuen dar, welche durch die Macht der Harmonie zu allen Leidenschaften des menschlichen Lebens empfänglich werden.«
Die belebten Statuen werden von Apoll, dem Gott der schönen Künste, Orpheus, Bacchus und zahlreichen Musen zu besseren Menschen erzogen. Beethoven setzt der abendfüllenden Ballettmusik eine strahlende Ouvertüre in C-Dur voran. Sie kündet von der Macht der Musik über den Menschen. Und vielleicht hatte der oder die ein oder andere Wiener Musikenthusiast:in das Thema des »Prometheus«-Finales noch in den Ohren, als ab Juni 1804 die erste klingende Ahnung der »Eroica«-Sinfonie an die Öffentlichkeit drang.
Denn im vierten Satz seiner dritten Sinfonie zitiert Beethoven seinen »Prometheus«: Noch einmal lässt er den aufmüpfigen Titanen zu Wort kommen und in vorwärtsdrängendem Rhythmus die Fackel der Freiheit hochhalten.
»Allein Freiheit, weiter gehn ist in der Kunstwelt, wie in der ganzen großen Schöpfung, Zweck«,
... lautet Beethovens (prometheischer) Leitspruch nicht von ungefähr.
»Veni, Veni, Emmanuel«. Schlagwerkkonzert
Entstehung: Dezember bis April 1992, komponiert im Auftrag von Christian Salvesen PLC für das Scottish Chamber Orchestra
Uraufführung: 10. August 1992 in der Royal Albert Hall, London (Scottish Chamber Orchestra; Solistin: Evelyn Glennie; Leitung: Jukka-Pekka Saraste)
Besetzung: 2 Flöten/Piccolo, 2 Oboen/Englisch Horn, 2 Klarinetten/Bassklarinette, 2 Fagotte/Kontrafagott, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, Pauken, Streicher
Solo Percussion: 2 Tamtams, Pauken, 2 Kleine Trommeln, 2 Congas, 6 Tomtoms, 2 Timbales, Große Trommel, 6 Chinesische Gongs, 6 Tempelblocks, Log Drum (Schlitztrommel), 2 Holzblocks, 2 Kuhglocken, Marimbafon, Mark Tree, große Becken, Sizzle Becken, Röhrenglocken
Er sei ein »Modernist«, sagt Sir James MacMillan. 1959 wurde er in der schottischen Grafschaft Ayrshire geboren, studierte Komposition in Edinburgh sowie im nordenglischen Durham und ist derzeit der wohl bedeutendste zeitgenössische Komponist Schottlands. Dass seine Musik in der Gegenwart verankert ist und aus den kompositorischen Mitteln der eigenen Zeit schöpft, ist nur die halbe Wahrheit. Vielmehr charakterisiert MacMillan sowohl als Mensch als auch als Komponist eine große Offenheit in alle Richtungen.

Nur in die Zukunft zu denken und die Vergangenheit dabei vollkommen abstreifen zu wollen, das sei ihm suspekt, bekennt der Schotte. Er selbst sagt, dass seine künstlerische Arbeit auf einer Art »Vergangenheitsbewältigung« beruhe. Zusätzlich zum Rückbezug auf die Musikgeschichte setzt sich der bekennende Katholik in seinen Werken auch mit den Traditionen des Glaubens und der Spiritualität auseinander.
Das spiegelt auch sein Werk »Veni, Veni, Emmanuel« für Schlagwerk und Orchester. Komponiert 1992, war es Pionierstück, denn die Gattung »Schlagwerkkonzert« erfährt ihren wahren Boom erst seit wenigen Jahrzehnten. An die Vergangenheit knüpft MacMillan darin trotzdem an. »Das Stück kann aus zweierlei Blickwinkeln betrachtet werden«, erläutert der Komponist.
»Auf der einen Ebene handelt es sich um eine völlig abstrakte Komposition, deren komplettes musikalisches Material aus dem französischen Advents-Choral aus dem 15. Jahrhundert abgeleitet wird. Auf der anderen Ebene ergründet es mit musikalischen Mitteln die theologische Bedeutung hinter der Adventsbotschaft.«
Das einsätzige, in acht Abschnitte gegliederte Konzert habe er am ersten Adventssonntag 1991 begonnen und am Ostersonntag 1992 vollendet. Herzschläge pulsieren durch alle Abschnitte und manifestieren sich gegen Ende in Trommel und Pauke. Ein Schlüssel zum Werk, so MacMillan:
»Sie stehen für die Menschwerdung und die Gegenwart Christi. Texte zum Advent verkündigen den Tag der Befreiung von Angst und Bedrückung. Dieses Werk ist ein Versuch, dies in Musik widerzuspiegeln.«
Der titelgebende Choral erklingt im letzten Abschnitt und bildet im vollen Bläsersatz den emotionalen Höhepunkt, bevor rituelles Geläut von Röhrenglocken das letzte entrückte Wort haben. »Ganz zum Schluss des Stücks nimmt die Musik eine liturgische Abkürzung vom Advent in Richtung Ostern – geradewegs hinein ins Gloria der Osternachtsfeier –, als finde die Proklamation der Freiheit ihre Verkörperung im auferstandenen Christus.« (MacMillan)

Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67
Entstehung: Skizzen zwischen 1803 und 1805, Ausarbeitung von Anfang 1804 bis März 1808
Uraufführung: 22. Dezember 1808 in einem selbst-veranstalteten Konzert Beethovens im Theater an der Wien, u. a. zusammen mit der Sinfonie Nr. 6 und dem Klavierkonzert Nr. 4 (Leitung: Ludwig van Beethoven)
Besetzung: Piccolo, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, Kontrafagott, 2 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, Pauken, Streicher
Ta ta ta taaa! Es gibt nur wenige Tonfolgen, die mit ähnlicher Vehemenz zum musikalischen Allgemeingut geworden sind wie die ersten vier Schläge von Ludwig van Beethovens fünfter Sinfonie. In die Jahre 1807/08 fällt die Hauptarbeitszeit an diesem Werk voller Wut, Verzweiflung, Frage und Anklage – aber auch voll von neugefasstem Lebensmut und Überschwang: eine Sinfonie, die wie keine andere auf dem Weg von Finsternis in strahlende Helligkeit stürmt, ja geradezu aus tiefster Bedrängnis ins pralle Leben. Natürlich stammt der romantisch-schwärmerische Beiname »Schicksalssinfonie« nicht vom Komponisten selbst, aber er ist zu naheliegend, um ihn zu ignorieren. Entlädt sich doch in dieser Sinfonie all der Frust, den Beethoven im berühmten »Heiligenstädter Testament« zusammengefasst hat.

»O ihr Menschen die ihr mich für feindselig störrisch oder misanthropisch haltet oder erkläret, wie unrecht tut ihr mir ...«,
... so beginnt Beethoven seinen als »Heiligenstädter Testament« bekannten Brief von 1802. Dieser richtet sich wie ein letzter Wille an die engsten Verwandten und kommt gleichzeitig einem Aufschrei gleich. Beethoven hadert mit seinem Schicksal, dass sein Gehör ihn verlässt. Von den Menschen fühlt er sich unverstanden, fürchtet den Bezug zu ihnen allmählich zu verlieren – und hofft auf den Tod. Allein seine Kunst habe ihn am Leben gehalten, notiert er da, denn er könne nicht aus demselben treten, bevor er »Gelegenheit gehabt habe, noch alle meine Kunstfähigkeiten zu entfalten«. Ein neuer Weg muss her, persönlich wie musikalisch.
Die fünfte Sinfonie legt Zeugnis davon ab. Musik ist für ihn ab sofort mehr als »tönend bewegte Formen« (nach einem berühmten Ausspruch des Musikphilosophen Eduard Hanslick). Sie transportiert eine Idee. »Per aspera ad astra« ist das unausgesprochene Programm der Fünften – durch Nacht zum Licht. Es ist genau das Programm, das der Komponist im erschütternden Brief aus Heiligenstadt seinem Leben gegeben hat: Zum Licht der Kunst führt ihn das quälende Schicksal seines Daseins.
Texte: Ilona Schneider
Gründungsmitglieder Arndt und Helmut Andreas Hartwig (Bonn)
Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)
Godesberg Gastronomie & Event GmbH
Olaf Wegner (Bad Honnef)
Wohnbau GmbH (Bonn)
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)
Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)
Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)
Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)
Bernd Böcking (Wachtberg)
Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)
Dr. Helga Hauck (Wachtberg)
Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)
Dr. Luciano und Ulrike Pizzulli (Bonn)
Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)
Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama
Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Heike Fischer und Carlo Fischer-Peitz (Königswinter) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Prof. Ingeborg Henzler und Dr. Mathias Jung (Bendorf-Sayn) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Matthiaß-Küster und Norbert Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)
Colin Currie ist ein Schlagzeuger, der sich für Neue Musik auf höchstem Niveau einsetzt und als »Gipfel der heutigen Schlagzeugkunst« (Gramophone) gefeiert wird. Führende Komponist:innen und Dirigent:innen schätzen ihn als Solisten. Er tritt mit Orchestern wie dem New York Philharmonic, dem Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam und dem Orchestre Philharmonique de Radio France auf. Der entdeckungsfreudige Interpret spielte Uraufführungen von Komponist:innen wie Steve Reich, Sir James MacMillan, Brett Dean, Einojuhani Rautavaara, Sir Harrison Birtwistle und vielen anderen.
Currie leitet seine eigene Colin Currie Group. Die Gruppe rief er 2006 mit persönlicher Unterstützung von Steve Reich ins Leben, um dessen Werk eine Plattform zu geben. 2017 gründete Currie gemeinsam mit LSO Live das Label Colin Currie Records, wo er hoch gelobte Aufnahmen in verschiedenen Formationen herausbringt. Currie ist Associate Artist am Royal Conservatoire of Scotland und Gastprofessor für moderne Ensembles an der Royal Academy of Music London. Als Dirigent leitete er bereits das London Symphony Orchestra und das Scottish Chamber Orchestra.
Der Dirigent und Pianist Maxim Emelyanchyev wurde 1988 geboren und studierte am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium. Seit 2013 ist er Chefdirigent des italienischen Originalklang-Ensembles Il Pomo d’Oro. Drei Programme des Ensembles mit der renommierten Sopranistin Joyce DiDonato sind auf CD erschienen. 2019 wurde Emelyanchyev Chefdirigent des Scottish Chamber Orchestra, mit dem er mittlerweile neben Schuberts »großer« C-Dur-Sinfonie auch Mendelssohns Sinfonien Nr. 3 und Nr. 5 eingespielt hat. Sein Vertrag wurde unlängst bis 2028 verlängert.
Als Gastdirigent debütierte Emelyanychev zuletzt beim Glyndebourne Festival, am Royal Opera House in London, beim Orchestre de Paris, beim London Philharmonic Orchestra, beim Mahler Chamber Orchestra, beim Orchestra of the Age of Enligthenment, beim Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam und bei den Berliner Philharmonikern. Highlights der aktuellen Spielzeit sind die Debüts beim City of Birmingham Symphony Orchestra und bei den Salzburger Festspielen. Ein wichtiges Projekt für die kommenden Jahre ist die Gesamteinspielung aller Mozart-Sinfonien mit Il Pomo d’Oro.

Das Scottish Chamber Orchestra (SCO) ist eines der fünf staatlich geförderten Bühnenensembles Schottlands und seit seiner Gründung im Jahr 1974 eine treibende Kraft in der schottischen Musikszene. Es ist davon überzeugt, dass der Zugang zu Musik von Weltrang für alle offenstehen sollte. Von klassischer Musik bis hin zu neu in Auftrag gegebenen Werken reicht das breit gefächerte Programm. Mit der Ernennung des jungen, dynamischen Dirigenten Maxim Emelyanychev zum Chefdirigenten des Orchesters im September 2019 begann für das SCO ein aufregendes neues Kapitel. Im November 2023 erschien die jüngste gemeinsame Einspielung.
Das SCO arbeitet seit vielen Jahren mit bedeutenden Gastdirigent:innen zusammen, darunter der Erste Gastdirigent Andrew Manze, Pekka Kuusisto und Richard Egarr. Enge Beziehungen zu führenden Komponist:innen sind dem Orchester wichtig, das rund 200 neue Werke in Auftrag gegeben hat, darunter Werke von Sir James MacMillan, Anna Clyne, Einojuhani Rautavaara, Karin Rehnqvist, Mark-Anthony Turnage und Peter Maxwell Davies.
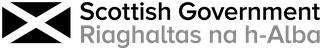
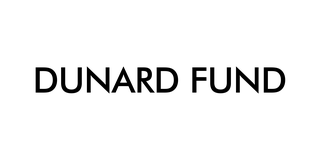
Violine 1: Stephanie Gonley, Afonso Fesch, Kyra Humphries, Aisling O’Dea, Amira Bedrush-McDonald, Esther Kim, Lyrit Milgram, Kirsty Main
Violine 2: Marcus Barcham Stevens, Ilhem ben Khalfa, Tom Hankey, Elvira van Groningen, Catherine James, Abigail Young, Jess Hall, Serena Whitmarsh
Viola: Max Mandel, Francesca Gilbert, Katie Heller, Steve King, Rebecca Wexler, Kathryn Jourdan
Violoncello: Philip Higham, Su-a Lee, Donald Gillan, Eric de Wit, Niamh Molloy
Kontrabass: Edward Merritt, Jamie Kenny, Ben Havinden-Williams
Flöte: André Cebrián, Marta Gómez, Adam Richardson
Piccolo: Marta Gómez, Adam Richardson
Oboe: Tom Blomfield, Katherine Bryer
Englischhorn: Katherine Bryer
Klarinette: Maximiliano Martín, William Stafford
Bassklarinette: William Stafford
Fagott: Cerys Ambrose-Evans, Alison Green, Gillian Horn
Kontrafagott: Alison Green
Horn: Kenneth Henderson, Jamie Shield, Gavin Edwards
Trompete: Peter Franks, Shaun Harrold, Simon Bird
Posaune: Duncan Wilson, Nigel Cox, Alan Adams
Pauke: Stefan Beckett
Schlagwerk: Colin Hyson
Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.
Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.
Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).
Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.
Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.
Programmheftredaktion:
Sarah Avischag Müller
Julia Grabe
Die Texte von Ilona Schneider sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.