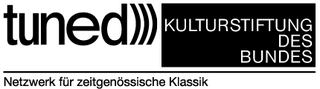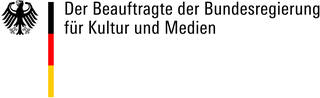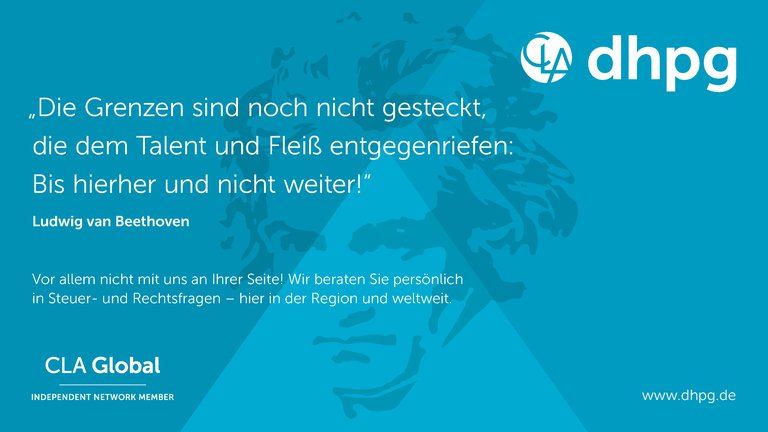Residenzkünstlerin Anastasia Kobekina zeigt im Solorecital ihre erstaunliche Vielseitigkeit im Wechsel zwischen Barockcello und modernem Cello – eine absolute Seltenheit.
Di 16.9.2025
19.30 Uhr, Kreuzkirche
Anastasia Kobekina: Solo
- Recital
- Vergangene Veranstaltung
- € 38 / 18

Mitwirkende
- Anastasia Kobekina Barockcello & modernes Violoncello
Programm
»O frondens virga«
Suite für Violoncello solo Nr. 2 d-Moll BWV 1008
»Narrenschiff«
»Song for Ainola«
Suite für Violoncello solo Nr. 1 G-Dur BWV 1007
»Pianissimo« aus »Grāmata čellam«
»Sketch«
Suite für Violoncello solo Nr. 3 C-Dur BWV 1009
»Fandango«
Auf einen Blick
Was erwartet mich?
Wie klingt das?
Nachklang
PublikumsgesprächNach dem Konzert laden wir zu dem besonderen Publikums-Austausch »Nachklang« unter einer der Emporen in der Kreuzkirche ein. In kleinen, zufällig ausgelosten Gruppen kommen Sie mit anderen Konzertbesucher:innen unverhofft ins Gespräch und entdecken gemeinsam neue Perspektiven auf das musikalische Erlebnis. Ein eigens entwickeltes Kartenspiel mit Einstiegs-Fragen sorgt für Impulse und bereichert den Austausch. Was hat Sie dazu inspiriert, heute Abend zum Konzert zu kommen? Welcher Moment im Konzert hat Sie besonders berührt? Wenn Sie das Violoncello der Künstlerin für einen Tag spielen könnten, was würden Sie damit machen? Und vielleicht kommt die Künstlerin des Abends, Anastasia Kobekina, auch an Ihren Tisch …
Bitte melden Sie sich vorab über das Formular unten an. Restplätze werden an der Abendkasse (Festivalzentrale) vergeben.
Beschreibung
Kaum etwas ist so »ultra« für Cellist:innen, wie Bachs Cellosuiten – ein Universum der Möglichkeiten auf dem Instrument. Residenzkünstlerin Anastasia Kobekina stellt sich zusätzlich der ultimativen Herausforderung, abwechselnd die Darmsaiten des Barockcellos und die Stahlsaiten des modernen Cellos zum Klingen zu bringen. Mit zeitgenössischen Solostücken findet sie berührende und persönliche Kommentare zu Bachs zeitloser Musik. Darunter sind einige unbekannte Neuentdeckungen: das temperamentvolle Solostück »Narrenschiff«, das ihr Vater Vladimir Kobekin für sie geschrieben hat, oder Bryce Dessners melancholische Bach-Paraphrase mit finnischem Sound. Subtil greifen die neuen Werke Aspekte der Bach-Suiten auf. Zuletzt folgt auf die freudige Gigue der C-Dur-Suite ein spanischer Fandango mit Kastagnetten.
Magazin
Alle Beiträge
Digitales Programmheft
Di 16.9.
19.30 Uhr, Kreuzkirche
Anastasia Kobekina: Solo
Mitwirkende
Anastasia Kobekina
Barockcello & modernes CelloProgramm
Hildegard von Bingen (1098–1179)
»O frondens virga«
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Suite für Violoncello solo Nr. 2 d-Moll BWV 1008
I. Prélude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Menuett I
VI. Menuett II
VII. Gigue
Vladimir Kobekin (*1947)
»Narrenschiff«
Bryce Dessner (*1976)
»Song for Ainola«
Johann Sebastian Bach
Suite für Violoncello Nr. 1 G-Dur BWV 1007
I. Prélude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Menuett I
VI. Menuett II
VII. Gigue
Pēteris Vasks (*1946)
»Pianissimo« aus »Grāmata čellam«
Penelope Axtens (*1974)
»Sketch«
Johann Sebastian Bach
Suite für Violoncello solo Nr. 3 C-Dur BWV 1009
I. Prélude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Bourée I
VI. Bourée II
VII. Gigue
Luigi Boccherini (1743–1805) / Giovanni Sollima (*1962)
»Fandango«
Über den Konzertabend
Konzertdauer: ca. 100 Minuten ohne Pause
Gastronomisches Angebot vor dem Konzert im Kirchenpavillon
Für ein ungestörtes Konzerterlebnis bitten wir Sie, auf Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.
Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.
Nachklang
Nach dem Konzert laden wir zu dem besonderen Publikums-Austausch »Nachklang« unter einer der Emporen in der Kreuzkirche ein. In kleinen, zufällig ausgelosten Gruppen kommen Sie mit anderen Konzertbesucher:innen unverhofft ins Gespräch und entdecken gemeinsam neue Perspektiven auf das musikalische Erlebnis.
Ein eigens entwickeltes Kartenspiel mit Einstiegs-Fragen sorgt für Impulse und bereichert den Austausch. Was hat Sie dazu inspiriert, heute Abend zum Konzert zu kommen? Welcher Moment im Konzert hat Sie besonders berührt? Wenn Sie das Violoncello der Künstlerin für einen Tag spielen könnten, was würden Sie damit machen? Und vielleicht kommt die Künstlerin des Abends, Anastasia Kobekina, auch an Ihren Tisch …
Restplätze werden an der Abendkasse (Festivalzentrale) vergeben.
Gefördert durch
Einleitung

Einleitung
Mit sechs Jahren spielte Anastasia Kobekina ihr erstes Konzert als Solistin mit Orchester, mit zwölf bestand sie die Aufnahmeprüfung am Moskauer Konservatorium. Bis zum ersten Preis beim TONALi-Musikwettbewerb dauerte es von da aus nur wenige Jahre – mittlerweile war sie unter anderem ›New Generation Artist‹ des BBC Radio 3 sowie Preisträgerin beim Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau und gewann den Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musik Festivals.
Als Residenzkünstlerin beim diesjährigen Beethovenfest Bonn zeigt sie sich von verschiedenen Seiten. Im heutigen Soloprogramm steht die Wandlungsfähigkeit ihres Instruments im Fokus. Sie stellt sich der Herausforderung, zwischen Barockcello und modernem Cello zu wechseln – auf den Konzertpodien selten zu erleben. Die Virtuosin schweift von frühmittelalterlichen Liedern über Bachs Cellosuiten zu zeitgenössischen Experimenten und Flamenco-Adaptionen, die das Cello zeitweise wie eine Gitarre klingen lassen. Anastasia Kobekina genießt es, Grenzen auszureizen – die des Repertoires, ihres Instruments und vor allem die ihrer eigenen Spieltechnik.
Zu den Stücken
Hildegard von Bingen
»O frondens virga«Auf einen Blick
Hildegard von Bingen (1098–1179): »O frondens virga«
Entstehung und Uraufführung: unbekannt
»Grünender Zweig«
– mit diesen Worten beginnt Hildegard von Bingens Lied »O frondens virga« –
»du stehst in deinem Adel, so, wie der Morgen anbricht (…) strecke deine Hand aus, um uns aufzurichten.«
Es ist eines von zwei Stücken, die nur in der früheren Handschrift ihres »Dendermonde-Codex« zu finden sind – vielleicht wurde es in der erweiterten Sammlung vergessen oder von Bingen zog es selbst aus dem Verkehr.
Die Melodie ist vergleichsweise einfach, sie bewegt sich die meiste Zeit um einen Ton herum – genau wie der Text um ein zentrales Motiv kreist: Der »grünende Zweig« kann hierbei als Metapher gesehen werden. Denn die Komponistin spricht gar nicht primär über die Natur, sondern über irdische Fruchtbarkeit und Weiblichkeit – mit dem Zweig meint die fromme Benediktinerin Maria. Die Farbe Grün steht in ihren Werken immer wieder für Konzepte wie die Kraft des Lebens oder den irdischen Ausdruck des Himmlischen.

Johann Sebastian Bach
Suiten für Violoncello Solo Nr. 1–3Auf einen Blick
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Suiten für Violoncello solo
Nr. 1 G-Dur BWV 1007
Nr. 2 d-Moll BWV 1008
Nr. 3 C-Dur BWV 1009
Entstehung: vor 1726
Uraufführungen: unbekannt
Die Melodie gehört neben den ersten Takten der Toccata in d-Moll wohl zu den bekanntesten, die Johann Sebastian Bach hinterlassen hat: Das Prélude aus seiner ersten Cellosuite zählt nicht nur zum Standardrepertoire für Cellist:innen, es erlangte ebenfalls großen Ruhm im popkulturellen Raum. In Filmen wie »Hangover«, »Elysium«, »Ex Machina« oder »The Pianist« taucht das latent mehrstimmige Thema prominent auf. Ebenso spukt es durch diverse Social-Media-Plattformen und begeistert immer mehr junge Menschen für das Werk des eigenbrötlerischen, barocken Komponisten.
Zugleich umwehen diese Suiten ein gewisses Geheimnis: Man weiß bis heute nicht genau, wann sie komponiert wurden. Die originalen Handschriften sind verschollen, wie bei vielen seiner Werke. Lediglich eine Kopie der Noten von Johann Peter Kellner um 1726 ist bekannt. Die Stücke waren lange verschrien als protzige Glanzstücke für Virtuos:innen – über Jahrhunderte führte sie kaum jemand auf. Der Cellist Pablo Casals war der erste, der Anfang des 20. Jahrhunderts wieder alle Suiten im Konzert präsentierte – ihm verdanken wir die Rückkehr dieser Musik in das öffentliche Bewusstsein.
Suite
Die Gattung war im Barock beliebt: ein mehrsätziges instrumentales Stück, das eine Reihe von Tanzsätzen enthält. Oft zählt zum Kernbestandteil dieser Tanztypen die Folge Allemande, Courante, Sarabande und Gigue – höfische Standardtänze besonders in Frankreich. Jeder Tanz hat typische Taktarten, Geschwindigkeiten und Rhythmus-Muster. Ob man auf Bachs Suiten tanzen kann, ist fraglich. Die Suite wurde häufig als Konzert- und Unterhaltungsmusik jenseits des Tanzsaals komponiert.
Ein Universum cellistischer Möglichkeiten
Tatsächlich sind die Suiten alles andere als leicht zu spielen. Bach treibt die Interpret:innen durch rasante Läufe und virtuose Doppelgriffe, fordert von ihnen schnelle Wechsel von Tonarten, Rhythmen, Stimmungen und Klangfarben – von Suite zu Suite steigt der Schwierigkeitsgrad. Für den Komponisten war das Cello noch ein recht junges Instrument – kaum erprobt, kaum mit Kompositionen bedacht – und so wirkt es, als würde er dieses neue Terrain mit jeder Suite mehr durchdringen.
Während die erste vor allem wie eine harmonische Studie wirkt, lebt die zweite von starker motivischer Arbeit. Der gebrochene Moll-Dreiklang zu Beginn zieht sich als eine Art Zentral-Motiv durch alle Sätze. In ihrer thematischen Geschlossenheit erinnert das Werk an Variationen-Suiten aus frühbarocker Vergangenheit. Dementgegen arbeitet sich die dritte Suite an verschiedenen Ausformungen von Arpeggien (Akkord-Brechungen) ab, womit Bach eine fesselnde Dramatik erzeugt – und zwar schon ab dem ersten Satz.

Vladimir Kobekin
»Narrenschiff«Auf einen Blick
Vladimir Kobekin (*1947): »Narrenschiff«
Uraufführung: Mai 2015
Zu dem Werk »Narrenschiff« hat Anastasia Kobekina eine ganz persönliche Verbindung: Der Komponist ist nämlich ihr Vater. Vladimir Kobekin widmet alle seine Werke seiner Tochter. 2018 spielt Anastasia sie ein – »Album by Father and Daughter« heißt die CD. Auch sein Stück »Narrenschiff« befindet sich darauf. Der Titel bezieht sich auf Platons gleichnamige Allegorie über ein Schiff mit dysfunktionaler Crew – ein Sinnbild für politische Führung ohne jegliche Expertise.
Für Kobekin treffen hier zwei Elemente aufeinander: das Meer und ein clownesker Tanz. Musikalisch rollen Wellen heran, die immer gewaltiger werden – Dissonanzen, die sich zunehmend reiben. Kurz darauf taucht aus dem Kräuseln der Wellen ein Tanzrhythmus hinauf an die Oberfläche – eine fröhliche Volksweise, die die Musik bald dominiert. Je mitreißender, grotesker und absurder dieser Tanz wird, desto unruhiger wird auch das Meer. Schließlich scheinen riesige Wellen das Schiff samt der auf ihm tanzenden Narren zu überfluten und in einem brachialen Strudel zu ertränken.

Bryce Dessner
»Song for Ainola«Auf einen Blick
Bryce Dessner (*1976): »Song for Ainola«
Uraufführung: 28. September 2024
»Ich sehne mich nach Ruhe und Frieden«
...schrieb Jean Sibelius zur Jahrtausendwende – mitten im Bauprozess seines zweistöckigen Blockbohlen-Hauses direkt am Tuunsula-See nördlich von Helsinki. Die Großstadt war für den damals knapp 40-jährigen Komponisten zu viel geworden:
»Meine Kunst verlangte eine andere Umgebung. In Helsinki starb jede Melodie in mir.«
Sein Haus, benannt nach seiner Frau Aino, steht noch immer: geräumig, zwei Schornsteine, weiße Fassade, mitten im Wald. The National-Bandmitglied und Komponist Bryce Dessner besuchte den Ort und schrieb unter dem Eindruck der »unglaublichen finnischen Landschaft« sein melancholisches Stück »Song for Ainola« – mit Bach im Hinterkopf.

Pēteris Vasks
»Pianissimo« aus »Grāmata čellam«Auf einen Blick
Pēteris Vasks (*1946): »Pianissimo« aus »Grāmata čellam«
Uraufführung: 10. Januar 1979
So nüchtern der Titel auch ist – »Grāmata čellam« bedeutet nicht mehr als »Buch für Violoncello« –, so zauberhaft schwebt die darunter zusammengefasste Musik: Das »Pianissimo«, das Anastasia Kobekina in diesem Konzert spielt, kontrastiert den ersten Satz des Buches mit dem Titel »Fortissimo«.
Sehr frei, beinahe improvisatorisch anmutend, bewegt sich die nachdenkliche Melodie über dem Orgelpunkt (ein über einen längeren Abschnitt gehaltener Ton) und spannt sich immer weiter auf. Die Interpretin begleitet dabei ihr Instrument mit ihrer Stimme und fügt der Melodie singend eine weitere Ebene hinzu. Vasks Musik liegt Anastasia Kobekina, »weil sie tief ins Innere des Menschen schaut und dessen Ängste und Hoffnungen sondiert«, wie der Bayerische Rundfunk es einst beschrieb. Kobekina selbst bestätigt das:
»Musik kann spiegeln, was man im Inneren empfindet, und helfen, wo Worte hilflos sind.«

Penelope Axtens
»Sketch«Auf einen Blick
Penelope Axtens (*1974): »Sketch«
Uraufführung: 8. Oktober 2024 durch Anastasia Kobekina
Nachdem Penelope ›Penny‹ Axtens vor 25 Jahren für ihr Werk »Part the Second« den Musikpreis des New Zealand Symphony Orchestra gewann, stieg sie in Neuseeland zur nationalen Berühmtheit auf. Und obwohl sie kurz darauf nach London und anschließend für einen Job als Marketing und Promotions-Managerin bei Sony nach Berlin zog, hält die Insel an der Begeisterung für die Komponistin fest: 2025 wählte die New Zealand School of Music sie zur Composer-in-Residence und verkündete 2024 glücklich Penelope Axtens »Rückkehr und neue Verbindung mit ihrer Heimat«. Währenddessen komponierte Axtens ihr Stück »Sketch« für Cello-Solo, das Anastasia Kobekina bei ihr in Auftrag gegeben und vergangenes Jahr uraufgeführt hat.

Luigi Boccherini
»Fandango«, arr. für Violoncello von Giovanni SollimaAuf einen Blick
Luigi Boccherini (1743–1805): »Fandango«, arr. für Violoncello von Giovanni Sollima (*1962)
Originalwerk: Boccherini: Streichquintett D-Dur op. 40/2 G. 341, II. Satz »Tempo di Fandango« (um 1788), 1798 vom Komponisten arrangiert für 2 Violinen, Viola, Violoncello und Gitarre.
Mit seinen zwölf Quintetten für Gitarre und Streichquartett komponierte Luigi Boccherini echte Gassenhauer – spanische Gitarrist:innen betrachten die Werke schnell als Teil ihrer wichtigsten Kammermusik. Dabei begann Boccherini erst spät damit, für Gitarre zu schreiben. Sein Mäzen Marquis de Benavente regte den Komponisten in den 1790er-Jahren dazu an, ältere Streich- und Klavierquintette für Gitarre umzuarbeiten.
Sein »Fandango-Quintett« – eigentlich das Gitarrenquintett D-Dur – wurde schnell beliebt unter den zeitgenössischen Gitarrist:innen. Giovanni Sollima arrangierte das Werk nun für Cello-Solo: Das Rasgueado etwa, den fächerartigen Anschlag mit der Hand, ahmt er mit dem Ricochet nach, das Abprallen-Lassen des Bogens von den Saiten. Außerdem schreibt er der Interpretin sogenannte Jaleos in die Partitur, die Flamenco-typischen Ausrufe.
Texte: Hannah Schmidt

Interview
Anastasia Kobekina
»Bachs Musik ist eine offene Frage«Bachs Cellosuiten sind ein Universum des Cellos. Erzähle von dem Ort, den diese Werke in Deinem Leben haben.
Anastasia Kobekina: Diese Musik begleitet mich wohl am längsten und ich habe sie am meisten aufgeführt. Egal, ob ich die Suiten für mich allein oder im Konzert spiele: Jedes Mal erlebe ich etwas Neues mit ihnen. Diese Musik tritt in Resonanz mit mir, mit derjenigen, die ich in dem Moment bin. Sie zu spielen bedeutet, eine innere Reise offenzulegen, wie ein Selbstporträt. Jedes Mal muss ich mich dafür verletzlich und mutig zeigen. Das ist die Größe dieser Werke. Sie sind eine offene Frage, die uns ewig dazu einlädt zu lauschen, zu erkunden, uns selbst zu finden.
Du hast Dich für das Bonner Konzert entschieden, Bachs Musik auf dem Barockcello zu spielen. Seit wann beschäftigst Du Dich mit der historischen Aufführungspraxis? Welchen Unterschied macht das für Dich?
Ich habe jahrelang nach dem Schlüssel zu Bachs Cellosuiten gesucht. Jede:r Lehrer:in oder Kolleg:in hat mir den eigenen Zugang als definitive Lösung angeboten, ›wie es gespielt werden soll‹. Aber mir leuchtete keiner davon ein. Das änderte sich, als ich die fantastische Barockcellistin Kristin von der Goltz kennenlernte. Sie hat mir die Welt der Barockmusik aufgeschlossen. Seit sieben Jahren studiere ich mit ihrer Begleitung dieses Repertoire und das historische Instrumentarium – und habe mich komplett in die Epoche verliebt. Was mich daran fasziniert, ist die grenzenlose Freiheit und Leidenschaft, die in der Barockmusik steckt – trotz der vielen historischen Quellen mit stilistischen Normen. Besonders der warme Klang von Darmsaiten ist für mich unnachahmlich: Er ist ehrlich und ungekünstelt. Das erweitert die eigene Vorstellungskraft und ermöglicht Experimente.
Du wirst im Konzert zwischen dem Barockcello und dem modernen Cello wechseln. Ist das eine Herausforderung?
Absolut. Für das Barockcello braucht man eine andere Technik als für das moderne. Auf den Darmsaiten ist das Spielgefühl völlig anders als auf Stahlsaiten. Es erfordert viel Geduld, um zu lernen, mit dem empfindlichen Barockcello umzugehen, zum Beispiel einen langsamen Bogenstrich zu kontrollieren. Innerhalb eines Konzerts muss man sich schnell umstellen können, um beide Celli zu spielen. Aber so kann es gelingen, mittels der Instrumente wie in einer Zeitmaschine zwischen den historischen Musikwelten zu reisen.
Du verbindest in Deinem Programm Bachs Cellosuiten Nr. 1 bis 3 mit zeitgenössischen Solowerken. Wie stehen sie in Beziehung zueinander?
Ich habe die modernen Stücke so ausgesucht, dass ihr charakteristischer Klang jede der Cellosuiten neu beleuchtet. So wird unsere Wahrnehmung der Alten Musik herausgefordert. Die zeitgenössische und die barocke Musik stehen im Kontrast, aber sie haben etwas Wichtiges gemeinsam: Sie bieten Freiheit für die Interpretation. Die Neue Musik hat noch keine Aufführungsgeschichte mit ikonischen Aufnahmen, die Hörgewohnheiten zementieren würden. Ich weiß nicht im Voraus, wie die Stücke klingen müssen – ich habe nur die Partitur. So öffnet sich ein endloser Raum für die Fantasie und für kreatives Ausprobieren.
Wir danken den Mitgliedern des Freundeskreises
MÄZEN
Gründungsmitglieder Arndt und Helmut Andreas Hartwig (Bonn)
PLATIN
Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)
Godesberg Gastronomie & Event GmbH
Olaf Wegner (Bad Honnef)
Wohnbau GmbH (Bonn)
GOLD
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)
Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)
Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)
Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)
SILBER
Bernd Böcking (Wachtberg)
Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)
Dr. Helga Hauck (Wachtberg)
Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)
Dr. Luciano und Ulrike Pizzulli (Bonn)
Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)
AUF EMPFEHLUNG unserer Mäzene Arndt und Helmut Andreas Hartwig
Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama
BRONZE
Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Heike Fischer und Carlo Fischer-Peitz (Königswinter) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Prof. Ingeborg Henzler und Dr. Mathias Jung (Bendorf-Sayn) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Matthiaß-Küster und Norbert Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Carrie Walter und Gabriel Beeby (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)
Biografie
Anastasia Kobekina
Als »konkurrenzlose Musikerin« von Le Figaro beschrieben, ist Anastasia Kobekina für ihre atemberaubende Musikalität und Technik, ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit und ihre ansteckende Persönlichkeit bekannt. Mit einem breiten Repertoire auf modernen und historischen Instrumenten hat sie sich als eine der aufregendsten Cellist:innen der jüngeren Generation etabliert. Sie trat mit weltweit renommierten Orchestern auf, wie den BBC Philharmonic, Kremerata Baltica und dem Kammerorchester Basel. Sie arbeitete mit Dirigent:innen wie Krzysztov Penderecki, Omer Meir Wellber und Charles Dutoit.
Anastasia Kobekina gewann die Bronzemedaille beim Internationalen Tschaikowsky Wettbewerb (2019) und den ersten Preis beim TONALi-Wettbewerb 2015 in Hamburg. Sie war BBC New Generation Artist und gewann den Borletti-Buitoni Trust Award (2022). Zu ihren Kammermusikpartner:innen zählen Gidon Kremer, Patricia Kopatchinskaja, Fazıl Say und Andras Schiff.
Im russischen Jekaterinburg geboren, erhielt sie ihren ersten Cellounterricht im Alter von vier Jahren. Nach ihrem Abschluss am Moskauer Konservatorium studierte sie weiter an der Kronberg Akademie, der Universität der Künste in Berlin und am Konservatorium von Paris. Derzeit absolviert sie ein Aufbaustudium an der Frankfurter Hochschule (Barockvioloncello).
Konzerttipps
Mehr für Cello-Ultras
beim BeethovenfestAwareness
Awareness
Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.
Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.
Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).
Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.
Das Beethovenfest Bonn 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.
Programmheftredaktion:
Sarah Avischag Müller
Julia Grabe
Die Texte von Hannah Schmidt sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.