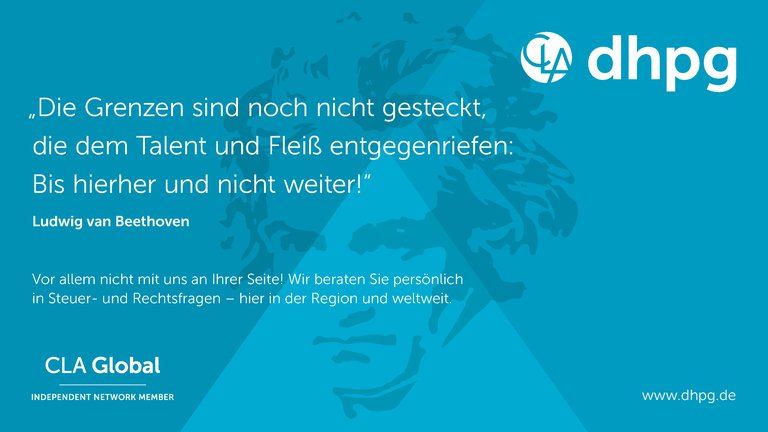Ein frisch mit dem Ponto-Musikpreis dekoriertes Nachwuchsquartett nimmt sich das mystische und zukunftsweisende Beethoven-Streichquartett op. 132 vor – ein Nonplusultra-Werk des Repertoires.
So 7.9.2025
11 Uhr, Beethoven-Haus Bonn
Preisträgerkonzert: Javus Quartett
- Kammermusik
- Vergangene Veranstaltung
- € 28

Mitwirkende
- Javus Quartett
- Marie-Therese Schwöllinger Violine
- Alexandra Moser Violine
- Marvin Stark Viola
- Oscar Hagen Violoncello
Programm
Streichquartett B-Dur op. 76/4 »Der Sonnenaufgang«
Streichquartett Nr. 1 f-Moll op. 16
Streichquartett Nr. 15 a-Moll op. 132
Auf einen Blick
Was erwartet mich?
Wie klingt das?
Beschreibung
Das Javus Quartett ist »dabei, eine ganz eigene künstlerische Handschrift zu entwickeln«. So urteilt die Jury des Jürgen Ponto-Musikpreises, der dem jungen österreichisch-deutschen Ensemble im Konzert überreicht wird. Künstlerisch spannend ist auch das Programm: Das theatralische und groß angelegte »Sonnenaufgang«-Quartett von Haydn und Beethovens op. 132, zwei Repertoire-Meilensteine, treffen auf eine Neuentdeckung von Hans Gál.
Gál, 1890 in eine jüdisch-ungarische Familie in Österreich geboren, machte sich in der Vorkriegszeit Wiens schnell einen Namen als Pianist, studierte Komposition und erhielt renommierte Professuren. Doch die Nationalsozialisten unterbrachen seine Karriere, und Gál floh ins Exil nach Edinburgh. Dort etablierte er sich als Hochschulprofessor, konnte aber nicht an die kompositorischen Erfolge der 1920er-Jahre anknüpfen. Seine Musik steht in der spätromantischen Tradition von Brahms und Strauss. Das frühe Streichquartett von 1916, das das Javus Quartett wiederbelebt, zeigt seine meisterhafte Handwerkskunst. Das ruhelose Scherzo und der langsame Satz, dessen spröde Klage an Schönbergs frühe, noch tonale Kammermusik erinnert, klingen modern und traditionsgebunden zugleich.
In Kooperation mit der Jürgen Ponto-Stiftung
Herunterladen
Weitere Infos

Digitales Programmheft
So 7.9.
11 Uhr, Beethoven-Haus Bonn
Preisträgerkonzert: Javus Quartett
Mitwirkende
Javus Quartett
Marie-Therese Schwöllinger Violine
Alexandra Moser Violine
Marvin Stark Viola
Oscar Hagen Violoncello
Programm
Joseph Haydn (1732–1809)
Streichquartett B-Dur op. 76/4 »Der Sonnenaufgang«
I. Allegro con spirito
II. Adagio
III. Menuet. Allegro – Trio
IV. Finale. Allegro ma non troppo
Hans Gál (1890–1987)
Streichquartett Nr. 1 f-Moll op. 16
I. Moderato, ma con passione
II. Molto vivace
III. Adagio
IV. Allegro energico, un poco sostenuto
Pause
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Streichquartett Nr. 15 a-Moll op. 132
I. Assai sostenuto. Allegro
II. Allegro ma non tanto
III. Molto adagio
IV. Alla marcia. Assai vivace
V. Allegro appassionato
Verleihung des Musikpreises 2024 der Jürgen Ponto-Stiftung zur Förderung junger Künstler an das Javus Quartett durch Prof. Gregor Sigl (Artemis Quartett)
Über den Konzertabend
Konzertdauer: ca. 125 Minuten
Für ein ungestörtes Konzerterlebnis bitten wir Sie, auf Foto- und Videoaufnahmen zu verzichten.
Zusätzlich zu Blumen schenken wir den Künstler:innen Blüh-Patenschaften, mit deren Hilfe in der Region Bonn Blumenwiesen angelegt werden.
In Kooperation mit
Einleitung
2024 beeindruckte das Javus Quartett die Jury der Jürgen Ponto-Stiftung mit Beherztheit und perfektem Zusammenspiel – im heutigen Konzert wird ihnen der Musikpreis nun übergeben. Bereits 2022 wurde das Javus Quartett zudem mit dem Hans-Gál-Preis ausgezeichnet. Gáls Musik, die in der reichen Wiener Musiktradition steht, liegt dem Ensemble am Herzen. Sein mitreißendes Streichquartett Nr. 1 von 1916 wurzelt in der multinationalen Klangwelt des habsburgischen Vielvölkerstaats, der kurz vor dem Untergang stand. Zwanzig Jahre später fand Gáls Karriere durch die ›Machtergreifung‹ der Nazis ein jähes Ende.
Zwei Klassiker des Repertoires ergänzen das Programm: Joseph Haydns unkonventionelles »Sonnenaufgangsquartett« und Ludwig van Beethovens kraftvolles vorletztes Streichquartett mit dem berühmten »Heiligen Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit«.
Haydn
Joseph Haydn
Streichquartett B-Dur op. 76/4 »Der Sonnenaufgang«Auf einen Blick
Komposition: 1797
Uraufführung: unbekannt
Erstdruck: 1799 gleichzeitig bei Longman & Clementi (London) und bei Artaria (Wien)
Gut zu wissen
Souverän führt das Quartett op. 76/4 Haydns Errungenschaften zusammen: liedhafte Melodien, volksmusikalische Würze, harmonische Raffinesse und nicht zuletzt eine bildhafte Idee.
»Feuer und neue Effekte«
Joseph Haydn hat die Gattung des Streichquartetts zwar nicht erfunden, aber er prägte ein Modell, das für die nächsten 150 Jahre Bestand haben sollte: das geistreiche ›Gespräch‹ zwischen vier gleichberechtigten Stimmen. Wie originell seine Lösungen waren, zeigt ein Ausspruch von Wolfgang Amadeus Mozart. Als der Komponist Leopold Koželuch eine besonders kühne Stelle in einem Haydn-Quartett kritisierte und meinte, das hätte er aber »nicht so gemacht«, konterte Mozart schlagfertig: »Ich auch nicht, und wissen Sie warum? Weil weder Sie noch ich auf diesen Einfall gekommen wären.« 1797 führte Haydn seine Kunst in diesem jungen Genre zur Vollendung. Die Streichquartettserie des Opus 76 erschien, und der englische Musikgelehrte Charles Burney schrieb begeistert an Haydn, wie sehr er diese Werke »voller Erfindung, Feuer, gutem Geschmack und neuen Effekten« bewunderte.
Das »Sonnenaufgangsquartett« beginnt mit einem musikalisch bildhaften Vorgang: Über einer ruhig liegenden Klangfläche schwingt sich eine elegante, mit einem Vorschlag verzierte Melodie in der ersten Violine aufwärts. Erst danach finden sich die vier Instrumente in voller Lautstärke zusammen. Es handelt sich hier nicht um Tonmalerei, wie bei dem prächtigen Sonnenaufgang im fast zeitgleich entstandenen Oratorium »Die Schöpfung«. Haydn führt den ›Durch-Nacht-zum-Licht‹-Gedanken in einem magischen, improvisiert wirkenden Klangfeld abstrakter aus. Dieses Material durchdringt den ganzen Satz. Im zweiten und dritten Satz demonstriert Haydn seine Kunst, volkstümliche Melodien und subtile Verarbeitung immer wieder überraschend zusammenzuführen.
»Unter den unzähligen Quartetten, die uns Haydn geschenkt hat, strahlt das ›Sonnenaufgangsquartett‹ für uns eine ganz besondere Wärme aus. Wir haben es ausgewählt, weil es aus unserer Sicht das ideale Pendant zu Beethovens Opus 132 bildet und somit einen stimmigen Rahmen für das Konzert schafft. Haydns ›Sonnenaufgangsquartett‹ sprüht geradezu vor lebensbejahender Energie. Die Musik wird am Anfang lieblich von der Sonne wachgeküsst und entwickelt im Laufe des Werkes einen unbändigen Optimismus. Diese Stimmung wollten wir bewusst dem tiefgründigen und von Lebenserfahrung gezeichneten späten Beethoven-Quartett Opus 132 gegenüberstellen.«
– Javus Quartett
Besonders viel gespielt wurden Haydns Werke in Liebhaberkreisen und adligen Soireen, aber durchaus auch vor öffentlichem Publikum. Das Opus 76 widmete er seinem Gönner, dem Grafen Joseph Erdődy. Der wirkungsvolle Beiname des B-Dur-Streichquartetts »Sonnenaufgangsquartett« stammt nicht vom Komponisten und ist nicht zu verwechseln mit seinen »Sonnenquartetten« op. 20.
Gál
Hans Gál
Streichquartett Nr. 1 f-Moll op. 16Auf einen Blick
Komposition: 1916
Uraufführung: 1916 in Wien durch das Rosé-Quartett (privat), offizielle Uraufführung 1924 durch das Kolbe-Quartett
Erstdruck: 1924 bei Simrock (Leipzig)
Gut zu wissen
Schlanke Lyrik, eine Prise Melancholie und ein Schuss Balkan-Folk: Hans Gáls frühes Streichquartett ist ein Juwel aus den letzten Jahren Österreich-Ungarns.
Wiener Tradition
Hans Gál wuchs im Wien der vorletzten Jahrhundertwende auf. Sein Mentor Eusebius Mandyczewski war ein enger Freund von Johannes Brahms, doch die Klarheit und der Witz Joseph Haydns waren ihm ebenfalls ein Vorbild. Auch die Melodienseligkeit Franz Schuberts und des Wiener Heurigenlieds sowie tänzerische Impulse aus den Balkanländern flossen in seine Werke ein. Gál war jüdisch-ungarischer Abstammung und somit Teil einer Community, die den unvergleichlichen kulturellen Reichtum der Metropole entscheidend mitprägte. Aber dieses Wien sollte sich nach dem Ersten Weltkrieg verändern. In den 1920er-Jahren nahm Gáls Karriere auch in Deutschland Fahrt auf: Vor allem seine komische Oper »Die heilige Ente« war ein Bühnenhit. 1929 wechselte er als Direktor an das Mainzer Konservatorium. Doch die glücklichen Jahre währten nur kurz.

Emigration und Neuanfang
Sofort nach der ›Machtergreifung‹ 1933 wurde Gál entlassen. Er ging zurück nach Wien, musste aber nach dem ›Anschluss‹ Österreichs emigrieren. Mit Frau und Kindern konnte er sich nach London retten und ließ sich später dauerhaft in Edinburgh nieder. Mehrere enge Familienmitglieder Gáls überlebten den Naziterror nicht. Gál starb im Alter von 97 Jahren in Edinburgh – als Hochschullehrer und Buchautor hochgeachtet, als Komponist jedoch weitgehend vergessen. Erst in den letzten Jahren hat man Gáls Musik wiederentdeckt, die Wienerische Spätblüte mit handwerklicher Meisterschaft verbindet.
Das erste Streichquartett
Nachdem Gál einige Jugendwerke vernichtet hatte, ließ er sein erstes Streichquartett von 1916 bestehen. Die Einflüsse von Brahms und Schubert sind ihm eingeschrieben. Doch gibt es auch fahle, sprödere Abschnitte, die von der anbrechenden Moderne künden. Das virtuose Scherzo mit seinen gezupften Abschnitten erinnert an die Streichquartette von Debussy und Ravel.
Sein Militärdienst im Ersten Weltkrieg führte Gál 1915 und 1916 nach Serbien, wo er weiterhin komponierte. Serbische Melodien gingen in seine Werke ein und hinterließen auch im ersten Streichquartett ihre Spuren.
Das Rosé-Quartett – mit Gustav Mahlers Schwager Arnold Rosé als erstem Geiger – brachte das Werk 1916 zur Uraufführung, »vermutlich aus dem Manuskript (…), unmittelbar, nachdem mein Vater das Werk vollendet hatte«, wie Gáls Tochter Eva Fox-Gál berichtet. Die offizielle Uraufführung, die mit der Drucklegung 1924 einherging, erfolgte durch das von der Geigerin Margarethe Kolbe-Jüllig gegründete Kolbe-Quartett. Da die gedruckten Noten eine Widmung an das berühmte Adolf Busch-Quartett tragen, ist es laut Eva Fox-Gál »wahrscheinlich«, dass dessen Mitglieder »es tatsächlich auch gespielt haben«.
Melancholie und Temperament
Das melancholische, »brahms’sche« Thema des ersten Satzes erhebt sich über einer unruhig »murmenden« Begleitfigur. Wie ein lichter Sonnenstrahl fällt das liedhafte, »schubert’sche« zweite Thema im Cello ein. Der schnelle zweite Satz ist von einer motorischen Energie getrieben und schließt mit fahlen, unheimlichen Klangfarben. Im Adagio singen Bratsche und Cello eine schwermütige Melodie. Sie wird in verschiedenen Variationen beleuchtet – mal zärtlich, mal dramatisch. Mit wilden Tanzsprüngen setzt das Finale ein. Vielleicht hat es Gál tatsächlich in Serbien aufgeschnappt. Doch solche Tanzweisen osteuropäischer Kapellen waren damals auch in Wien überall zu hören.
»Als Preisträger des Hans Gál-Preises begann für uns eine ganz besondere Beziehung zur Musik dieses Komponisten. Für unser Preisträgerkonzert im Dezember 2022 wählten wir sein erstes Streichquartett – ein Werk, das uns seitdem sehr ans Herz gewachsen ist. Es bereitet uns jedes Mal aufs Neue eine riesige Freude, es auf die Bühne zu bringen. Das f-Moll-Quartett ist ein wunderbares Werk, das leider viel zu selten gespielt wird. Was diese Verbindung für uns aber wirklich einzigartig macht, ist die persönliche Begegnung mit Gáls Tochter, Eva Fox-Gál. Sie beim Preisträgerkonzert kennenzulernen und ihre Geschichten über ihren Vater zu hören, hat unserer Beziehung zu seiner Musik eine menschliche Tiefe gegeben. Aus dieser Verbindung ist auch eine Art Verpflichtung gewachsen. Wir empfinden es als unsere Aufgabe, die Musik von Hans Gál einem breiteren Publikum vorzustellen. Sein Schaffen ist aufgrund der politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts viel zu lange unbeachtet geblieben – ein Unrecht, wie wir finden. In seiner Musik steckt so viel Schönheit und ehrliches Gefühl. Gáls erstes Quartett in f-Moll ist durch seine spätromantische Tonsprache besonders zugänglich. Es besticht durch lange, einprägsame Kantilenen, kombiniert mit typisch österreichischem Charme und Witz.«
– Javus Quartett
Beethoven
Ludwig van Beethoven
Streichquartett Nr. 15 a-Moll op. 132Auf einen Blick
Komposition: 1824/25
Uraufführung: privat am 9. und 11. September 1825; öffentlich am 6. November 1825; jeweils in Wien durch das Schuppanzigh-Quartett
Erstdruck: 1827 bei Schlesinger (Berlin und Paris)
Gut zu wissen
Während der intensiven Arbeit an seinem 15. Streichquartett wurde Beethoven durch eine schwere Krankheit ausgebremst. Die Genesung feierte er im langsamen Satz des Stücks. Es ist, wie die Schwesterwerke op. 130 und op. 131, ein Auftragswerk des russischen Fürsten Nikolaus von Galitzin und ihm gewidmet.
Autobiografisches Bekenntnis
In der handschriftlichen Partitur des Adagios aus dem Streichquartett op. 132 setzte Ludwig van Beethoven mit zittriger Schrift links oben über die Noten eine besondere Überschrift. Ursprünglich sollte der dritte Satz wohl nur heißen: »Heiliger Gesang an die Gottheit«. Dann aber fügte er zwei ganz persönliche Einschübe hinzu: »Dank« und »eines Genesenen«. Als »Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit« liest sich dieses Adagio wie ein autobiografisches Bekenntnis.
Seit langem war Beethoven vollständig ertaubt. Zudem litt er immer wieder an quälenden Erkrankungen der inneren Organe, so auch 1825, während der Entstehung des a-Moll-Streichquartetts. Der innige Choral in einer alten Kirchentonart vereint die vier Instrumente zu einem seelischen Aufschwung in überirdischer Abgeklärtheit. Dann bricht eine neue Passage jäh mit ›neuer Kraft‹ hervor: ein belebtes Zwischenspiel, ein Auf- und Durchatmen. Hörbar schüttelt der Genesene die Krankheit ab und nimmt den Dankgesang wieder auf.

Kraft und Gegenkraft
Zögerlich, fast selbstquälerisch auch der Beginn des ersten Satzes. Spannung und Entspannung, Kraft und Gegenkraft bestimmen seinen Verlauf. Auch das Scherzo schleicht geheimnisvoll aus einer dunklen Tiefe hervor, um dann zu lichter Farbigkeit zu finden.
Nach dem großen »Dankgesang« als Herzstück folgt ein energischer Geschwindmarsch. Er bricht plötzlich ab und weicht einer Überleitung, in der die Instrumente aufgeregt miteinander zu reden scheinen. Dann nimmt ein leidenschaftliches Allegro Fahrt auf, das in extreme Tonlagen führt und seine Kraft schließlich im langen Bogen ausschwingen lässt.
Text: Kerstin Schüssler-Bach
»Kaum eine Musik spiegelt das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen so unmittelbar wider wie Beethovens späte Streichquartette. Sie sind für uns als Quartett ein Ort tiefster Erfahrung. Das Opus 132 ist in diesem Kosmos noch einmal etwas ganz Besonderes. Es sprengt alle Regeln und Formen, die bis dahin galten. Man hat das Gefühl, Beethoven verzichtet hier auf jedes romantische Pathos und gibt stattdessen einen völlig klaren, fast nüchternen Einblick in seine Seele. Diese Musik ist so menschlich, so verletzlich und gleichzeitig so stark in ihrer spirituellen Tiefe – das berührt uns jedes Mal zutiefst.«
– Javus Quartett
Wir danken den Mitgliedern des Freundeskreises
MÄZEN
Gründungsmitglieder Arndt und Helmut Andreas Hartwig (Bonn)
PLATIN
Dr. Michael Buhr und Dr. Gabriele Freise-Buhr (Bonn)
Godesberg Gastronomie & Event GmbH
Olaf Wegner (Bad Honnef)
Wohnbau GmbH (Bonn)
GOLD
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Andernach)
Andrea und Ekkehard Gerlach (Bonn)
Hans-Joachim Hecek und Klaus Dieter Mertens (Meckenheim)
Dr. Thomas und Rebecca Ogilvie (Bonn)
SILBER
Bernd Böcking (Wachtberg)
Dr. Sigrun Eckelmann† und Johann Hinterkeuser (Bonn)
Dr. Helga Hauck (Wachtberg)
Dr. Stefanie Montag und Dr. Stephan Herberhold (Bonn)
Jannis Ch. Vassiliou und Maricel de la Cruz (Bonn)
AUF EMPFEHLUNG unserer Mäzene Arndt und Helmut Andreas Hartwig
Tim Achtermeyer MdL * Judith und Tobias Andreae * Dr. Frank Asbeck und Susanne Birkenstock * Bettina Böttinger und Martina Wziontek * Anja Bröker * Philipp Buhr und Marie-Madeleine Zenker * Katja Burkard und Hans Mahr * Claudia Cieslarczyk und Heiko von Dewitz * Rüdiger und Andrea Depkat * Guido Déus MdL * Prof. Dr. Udo und Bettina Di Fabio * Walter Droege und Hedda im Brahm-Droege * Ralf und Antje Firmenich * Tobias Grewe und Dr. Jan Hundgeburth * Jörg Großkopf und Peter Daubenbüchel * Prof. Monika Grütters * Lothar und Martha Harings * Dr. Bernhard Helmich und Mai Hong * Dr. Eckart und Ulla von Hirschhausen * Dr. Sabine Hoeft und Thomas Geitner * Prof. Dr. Frank G. und Ulrike Holz * Prof. Dr. Wolfgang und Dr. Brigitte Holzgreve * Martin Hubert und Martina und Martha Marzahn * Stephan und Sirka Huthmacher * Dirk und Viktoria Kaftan * Dr. Christos Katzidis MdL und Ariane Katzidis * Andrea, Tim und Jan Kluit und Edgar Fischer * Dr. Eva Kraus * Dr. Markus Leyck Dieken und Peter Kraushaar * Peter und Katharina Limbourg * Nathanael und Hanna Liminski * Horst und Katrin Lingohr * Marianne und Stefan Ludes * Dr. Peter Lüsebrink und Karl-Heinz von Elern * Michael Mronz und Markus Felten * Prof. Dr. Georg und Doris Nickenig * Alexandra Pape und Malte von Tottleben * Hans-Arndt und Julia Riegel * Prof. Dr. Manuel und Aila Ritter * Matthias und Steffi Schulz * Stephan Schwarz und Veronika Smetackova * Prof. Walter Smerling und Beatrice Blank * Peter und Annette Storsberg * Prof. Burkhard und Friederike Sträter * Prof. Dr. Hendrik Streeck MdB und Paul Zubeil * Ulrich und Petra Voigt * Oliver und Diane Welke * Dr. Vera Westermann und Michael Langenberg * Dr. Matthias Wissmann und Francisco Rojas * Christian van Zwamen und Gerd Halama
BRONZE
Jutta und Ludwig Acker (Bonn) * Alexandra Asbeck (Bonn) * Dr. Rainer und Liane Balzien (Bonn) * Munkhzul Baramsai (Bonn) * Christina Barton van Dorp und Dominik Barton (Bonn) * Christoph Beckmanns (Bonn) * Prof. Dr. Christa Berg (Bonn) * Prof. Dr. Arno und Angela Berger (Bonn) * Christoph Berghaus (Köln) * Klaus Besier (Meckenheim) * Ingeborg Bispinck-Weigand (Nottuln) * Christiane Bless-Paar und Dr. Dieter Paar (Bonn) * Dr. Ulrich und Barbara Bongardt (Bonn) * Anastassia Boutsko (Köln) * Anne Brinkmann (Bonn) * Ingrid Brunswig (Bad Honnef) * Lutz Caje (Bramsche) * Elmar Conrads-Hassel und Dr. Ursula Hassel (Bonn) * Ingeborg und Erich Dederichs (Bonn) * Geneviève Desplanques (Bonn) * Irene Diederichs (Bonn) * Christel Eichen und Ralf Kröger (Meckenheim) * Elisabeth Einecke-Klövekorn (Bonn) * Heike Fischer und Carlo Fischer-Peitz (Königswinter) * Dr. Gabriele und Ulrich Föckler (Bonn) * Prof. Dr. Eckhard Freyer (Bonn) * Andrea Frost-Hirschi (Spiez/Schweiz) * Johannes Geffert (Langscheid) * Silke und Andree Georg Girg (Bonn) * Margareta Gitizad (Bornheim) * Carsten Gottschalk (Koblenz) * Ulrike und Axel Groeger (Bonn) * Marta Gutierrez und Simon Huber (Bonn) * Cornelia und Dr. Holger Haas (Bonn) * Sylvia Haas (Bonn) * Christina Ruth Elise Hendges (Bonn) * Renate und L. Hendricks (Bonn) * Peter Henn (Alfter) * Heidelore und Prof. Werner P. Herrmann (Königswinter) * Dr. Monika Hörig * Georg Peter Hoffmann und Heide-Marie Ramsauer (Bonn) * Dr. Francesca und Dr. Stefan Hülshörster (Bonn) * Karin Ippendorf (Bonn) * Angela Jaschke (Hofheim) * Dr. Michael und Dr. Elisabeth Kaiser (Bonn) * Agnieszka Maria und Jan Kaplan (Hennef) * Dr. Hiltrud Kastenholz und Herbert Küster (Bonn) * Dr. Reinhard Keller (Bonn) * Dr. Ulrich und Marie Louise Kersten (Bonn) * Rolf Kleefuß und Thomas Riedel (Bonn) * Dr. Gerd Knischewski (Meckenheim) * Norbert König und Clotilde Lafont-König (Bonn) * Sylvia Kolbe (Bonn) * Dr. Hans Dieter und Ursula Laux (Meckenheim) * Ute und Dr. Ulrich Kolck (Bonn) * Manfred Koschnick und Arne Siebert (Bonn) * Lilith Matthiaß-Küster und Norbert Küster (Bonn) * Ruth und Bernhard Lahres (Bonn) * Renate Leesmeister (Übach-Palenberg) * Gernot Lehr und Dr. Eva Sewing (Bonn) * Traudl und Reinhard Lenz (Bonn) * Florian H. Luetjohann (Kilchberg, CH) * Moritz Magdeburg (Brühl) * Dr. Charlotte Mende (Bonn) * Heinrich Meurs (Swisttal-Ollheim) * Heinrich Mevißen (Troisdorf) * Dr. Dr. Peter und Dr. Ines Miebach (Bonn) * Karl-Josef Mittler (Königswinter) * Dr. Josef Moch (Köln) * Esther und Laurent Montenay (Bonn) * Katharina und Dr. Jochen Müller-Stromberg (Bonn) * Dr. Nicola und Dr. Manuel Mutschler (Bonn) * Dr. Gudula Neidert-Buech und Dr. Rudolf Neidert (Wachtberg) * Gerald und Vanessa Neu (Bonn) * Lydia Niewerth (Bonn) * Wolfram Nolte (Bonn) * Mark und Rita Opeskin (Bonn) * Céline Oreiller (Bonn) * Carol Ann Pereira (Bonn) * Gabriele Poerting (Bonn) * Dr. Dorothea Redeker und Dr. Günther Schmelzeisen-Redeker (Alfter) * Ruth Schmidt-Schütte und Hans Helmuth Schmidt (Bergisch Gladbach) * Bettina und Dr. Andreas Rohde (Bonn) * Astrid und Prof. Dr. Tilman Sauerbruch (Bonn) * Ingrid Scheithauer (Meckenheim) * Monika Schmuck (Bonn) * Markus Schubert (Schkeuditz) * Simone Schuck (Bonn) * Petra Schürkes-Schepping (Bonn) * Dr. Manfred und Jutta von Seggern (Bonn) * Dagmar Skwara (Bonn) * Prof. Dr. Wolfram Steinbeck (Bonn) * Dr. Andreas Stork (Bonn) * Michael Striebich (Bonn) * Dr. Corinna ten Thoren und Martin Frevert (Bornheim) * Verena und Christian Thiemann (Bonn) * Silke und Andreas Tiggemann (Alfter) * Dr. Sabine Trautmann-Voigt und Dr. Bernd Voigt (Bonn) * Katrin Uhlig (Bonn) * Susanne Walter (Bonn) * Dr. Bettina und Dr. Matthias Wolfgarten (Bonn)
Biografie
Javus Quartett
Die vier jungen Musiker:innen hatten schon viele Jahre in den verschiedensten Besetzungen miteinander gespielt, als sie 2016 das Javus Quartett gründeten. Sie wurden in ihrer Entwicklung maßgeblich durch Lukas Hagen, dem ersten Geiger des Hagen Quartetts, beeinflusst. Derzeit studiert das Ensemble bei Johannes Meissl (Artis Quartett) an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien sowie an der Universität der Künste Berlin bei Gregor Siegl (Artemis Quartett) und erhält Impulse durch die Arbeit mit den führenden Kammermusikprofessor:innen der Welt. Besonders hervorzuheben sind Eberhard Feltz, Hatto Beyerle, Gerhard Schulz, Valentin Erben, Rainer Schmidt und Thomas Adès. Ihre rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland führte sie unter anderem in renommierte Konzerthäuser wie den Wiener Musikverein, das Konzerthaus Wien, das Konzerthaus Blaibach, die Stiftung Mozarteum Salzburg sowie zu Musikfestivals wie dem Mattseer Diabelli Sommer und der Mozartwoche Salzburg.
Zu ihren Kammermusikpartner:innen gehören Valentin Erben vom Alban Berg Quartett, Jean und Agnes Sulem, Matthias Schorn sowie Pauline Sachse. Das Quartett wurde 2024 mit dem Musikpreis der Jürgen Ponto-Stiftung, 2022 mit dem Hans Gál-Preis, dem Musica Juventutis Preis, dem Zukunftsklang Award Stuttgart sowie 2020 mit dem Publikumspreis des Irene Steels Wilsing Wettbewerbs im Rahmen des Musikfestivals Heidelberger Frühlings ausgezeichnet.
Konzerttipps
Mehr Kammermusik
beim BeethovenfestAwareness
Awareness
Wir – das Beethovenfest Bonn – laden ein, in einem offenen und respektvollen Miteinander Beethovenfeste zu feiern. Dafür wünschen wir uns Achtsamkeit im Umgang miteinander: vor, hinter und auf der Bühne.
Für möglicherweise auftretende Fälle von Grenzüberschreitung ist ein internes Awareness-Team ansprechbar für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen.
Wir sind erreichbar über eine Telefon-Hotline (+49 (0)228 2010321, im Festival täglich von 12–20 Uhr) oder per E-Mail (awareness@beethovenfest.de).
Werte und Überzeugungen unseres Miteinanders sowie weitere externe Kontaktmöglichkeiten können hier auf unserer Website aufgerufen werden.
Das Beethovenfest Bonn 2024 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.
Programmheftredaktion:
Sarah Avischag Müller
Julia Grabe
Die Texte von Kerstin Schüssler-Bach sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.