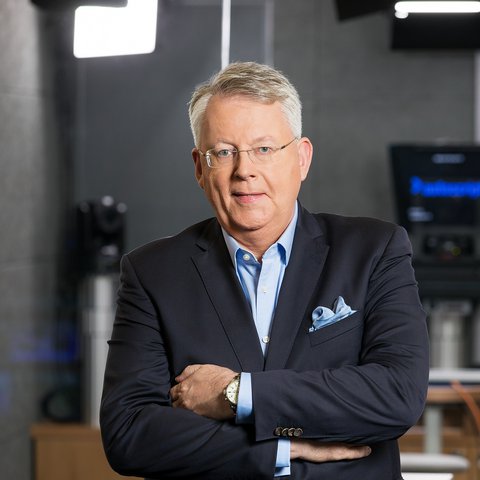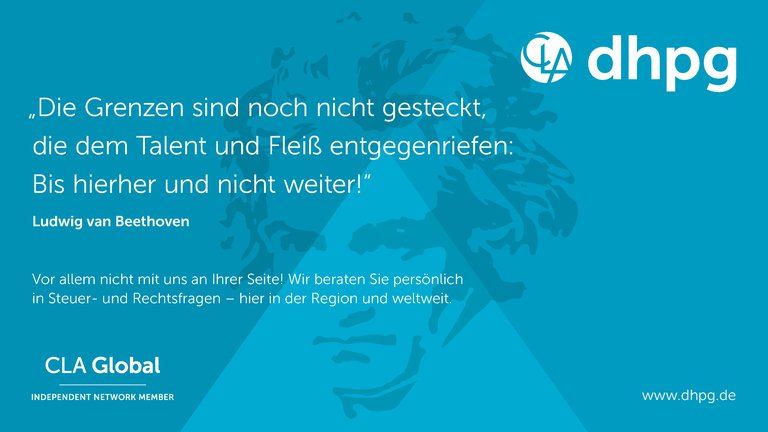Beethovens Musik ist, wie die europäische ›klassische‹ Musik überhaupt, über den Kolonialismus nach Afrika gelangt. Musik ausübende Siedler:innen sowie Missionseinrichtungen führten ihre Musik auch bei den Kolonisierten ein, meist einhergehend mit einer Geringschätzung von deren Kulturen.
Gerade die Musik diente in den kolonialen Ideologien auch als Beleg für die behauptete ›Überlegenheit der weißen Rasse‹ und deren Anspruch auf Vorherrschaft. So wurde westliche Musik zu einem Werkzeug kolonialer Machtausübung – zur »colonizing force«, wie es der ghanaische Musikwissenschaftler Kofi Agawu formuliert hat.
Trotz dieser kolonialen Vorgeschichte gab und gibt es in Afrika Menschen, die sich für die ›klassische‹ Musik begeistern. Kinder und Jugendliche kommen oft schon früh damit in Berührung. »In meiner Kirche«, erzählt Mary Olaniran, »verwenden wir klassische Instrumente, wie Violinen, Blockflöten, Klarinetten, Querflöten und Blechblasinstrumente, und so begann ich mich schon als Kind dafür zu interessieren.«
Aus dieser ersten Begegnung wurde Begeisterung, wie Michael Omoniyi bestätigt: »Wir wollten unbedingt klassische Musik lernen – Beethoven, Mozart und andere große Komponisten. Ich hab mich in sie verliebt.«
Junge Musiker:innen wie Mary und Michael suchen darüber hinaus »nach Wegen, Afrobeat und klassische Musik zu verbinden. Viele unserer berühmten Künstler:innen verwenden ja schon westliche Instrumente im Afrobeat.«
Auch wenn die Beteiligten die klassische Musik in erster Linie als Bereicherung empfinden: Transtraditionelle Projekte wie dieses blenden das koloniale Erbe, das bei der Probenarbeit zunächst in den Hintergrund getreten war, nicht aus – und liefern im besten Fall den Soundtrack zu einer kritischen, künstlerisch produktiven Auseinandersetzung.